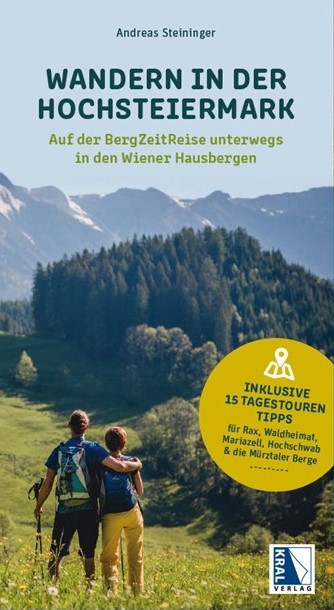©Sandra Oblak
Bei den Nächten der Philosophie wird vom 22.–26. Mai an verschiedenen Locations bei freiem Eintritt über Philosophie gesprochen. Veranstaltungen u. a. von Lisz Hirn (Nietzsche und die Frauen), Regula Stämpfli (Die Hannah-Arendt-Kontroversen), Alfred Pfabigan (When I’m 64. Altern als Kunst) und Simone Klein (Philosophisches im Wiener Lied und Austropop). Programm: www.gap.or.at
Zur Einstimmung bringen wir ein Interview mit Anna Gius, die über „Die Schwierigkeit zu lieben“ referieren wird.
Anna Gius ist geborene Südtirolerin und kam zum Studium nach Wien, wo sie sich später in der „Philosophischen Praxis“ engagierte. In dieser Einrichtung können Gespräche mit ihr – auch etwa als Paar – zu persönlichen Problemen gebucht werden, es soll ein philosophisches Reflektieren über das eigene Leben stattfinden. Daneben arbeitet Gius in der Kinder- und Jugendkultur bei WIENXTRA.
Philosophie als Lebenshilfe. Wie geht das?
Anna Gius: Ich habe das zum ersten Mal bei mir selbst erfahren, als ich als Jugendliche begonnen habe, Sartre zu lesen – das hat mich damals komplett abgeholt. Als ich dann entdeckt habe, dass es den Lehrgang „Philosophische Praxis“ gibt, war für mich klar, dass das ein Ort sein kann, wo ich viel finden und viel geben kann. Meine Steckenpferde wurden dann Liebe und Beziehungen. Deshalb machen Paarsettings bei mir Sinn, gerade wenn sich Paare abseits von normativen Beziehungslogiken bewegen. Aber ich denke: Egal, wo man sich umtreibt, ist philosophisches Handeln notwendig, denn es geht darum, Denkprozessen eine Tiefe zu geben und Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen.
Sie werden bei den „Nächten der Philosophie“ über die romantische Liebe sprechen – das ist ja das Klischee schlechthin, oder?
Genau, ich möchte weniger über die Liebe in der Philosophie reflektieren als über die Liebe im Leben. Das Romantikideal ist eine machtvolle Vorstellung, wenn es um ein gutes und glückliches Leben geht. Ich finde es gerade heute wichtig, Philosophie mit den Erkenntnissen aus anderen Fachbereichen zu verschränken. Die Glücksforschung zeigt uns etwa ganz deutlich, was Menschen am wichtigsten für ihr eigenes Glück erkennen, nämlich die Beziehungen, die sie führen. Gleichzeitig berichten Soziolog*innen, dass Menschen gerade dabei Erfahrungen des Scheiterns machen. Mich interessiert die Verschränkung von gesellschaftlichen Normvorstellungen mit den eigenen Selbsterzählungen – also dem eigenen Bewusstsein des Individuums, als das man sich sieht.
Das Scheitern ist in der romantischen Liebe ja fast schon angelegt – also die Liebe zu einem, einer und das für immer und ewig …
Obwohl wir alle anerkennen, wie unwahrscheinlich und selten die Erfüllung dieses Ideals ist, hören wir trotzdem nicht auf, es zu verfolgen. Wir müssen das Ideal hinterfragen, ohne den Wunsch nach liebevollen, erfüllenden Beziehungen aufzugeben. Viele Potenziale, die vorhanden sind, werden nicht genutzt. Wir haben sehr viel mehr Handlungsspielräume, ein erfülltes Leben zu führen und erfüllt zu lieben, als wir uns bewusst machen.
Nun gab es ja schon in den 60er-Jahren andere Formen wie die „freie Liebe“, aber das ist ja oft in der Praxis gescheitert …
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum alternative Beziehungsmodelle bisher nicht breitenwirksam geworden sind. Zum einen hat man nicht ehrlich genug auf die Auswirkungen und Handlungspraktiken im Patriarchat geschaut und zum anderen hat es gesellschaftliche Gegeninteressen gegeben, die das erschwert haben. Die Kleinfamilie galt als ein gesellschaftlich stabilisierender Faktor. Es wurden also Machtdynamiken übernommen, die nur die Verhältnisse reproduzieren und keine wirklichen Veränderungen ermöglichen können. Solange wir so starke patriarchale Hierarchien in unsere intimsten Beziehungen mitnehmen und dort keine Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit erlauben, werden wir scheitern.
Sie sprechen konkret über die Schwierigkeiten in der Liebe. Was sind die größten Schwierigkeiten?
Ich gehe von der lebenskundlichen Erfahrung aus, dass wir alle sehr vertraut sind mit Liebeskummer und vielleicht auch mit der Erkenntnis, dass es ein Ideal ist, an dem wir scheitern, und nicht die Liebe an sich. Die Schwierigkeiten können sehr individuell sein, deshalb ist gerade ein philosophisches Gespräch ein guter Ort, um sich das anzuschauen. Wenn wir in der Liebe eigene Wege gehen, gibt es auch Schwierigkeiten, denen wir alle begegnen: dass wir gelernt haben, dass Eifersucht natürlich ist und ein Beweis der Stärke unserer Gefühle zum Beispiel, oder dass es nicht möglich ist, mehrere Menschen gleichzeitig romantisch zu lieben, oder dass die romantische Liebesbeziehung wichtiger sein muss als Freund*innenschaften.