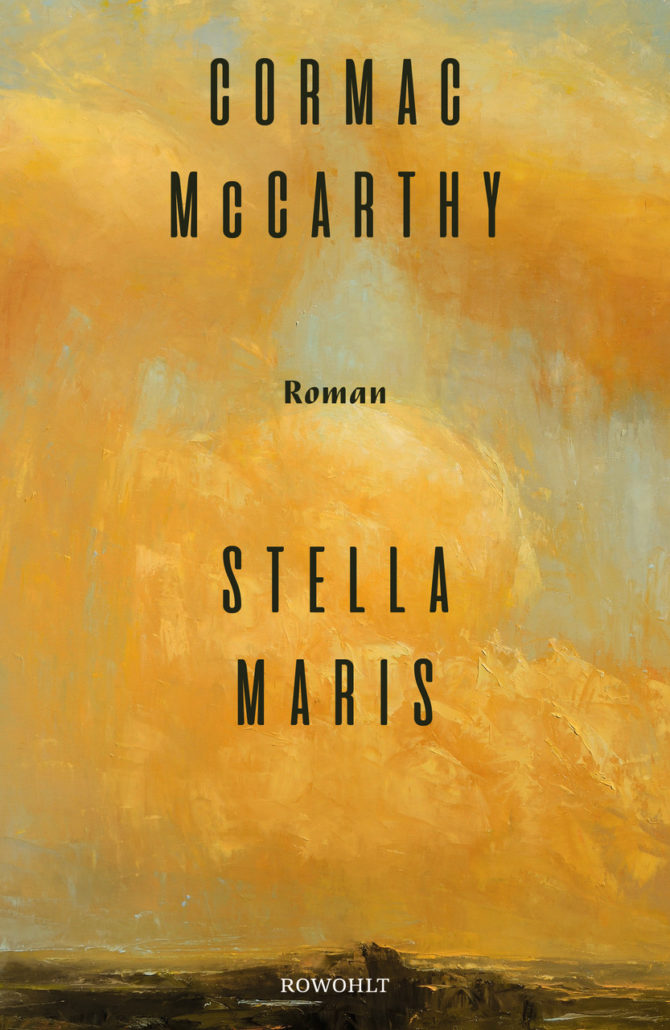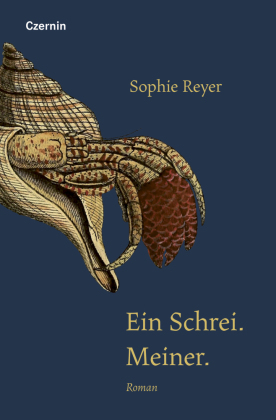Eine gestörte Familie in Argentinien – Aurora Venturinis „Die Cousinen“ ist eine literarische Entdeckung
Aurora Venturini erlebte erst mit 85 ein Zipfelchen von Ruhm, als sie für ihren Roman „Die Cousinen“ 2007 einen nationalen argentinischen Preis erhielt. 2015 starb die 1922 Geborene, die während ihrer Pariser Jahre mit Sartre und Beauvoir verkehrte und mit Eva Perón befreundet war. Sie schrieb zahlreiche Romane, aber erst jetzt bringt dtv ihre „Cousinen“ auf Deutsch heraus – ein sehr ungewöhnlicher Text, auch ein ungewöhnlich guter.
Es geht um die zu Beginn noch minderjährige Yuna. Sie beschreibt sich selbst als „minderbemittelt“, wenngleich nicht so extrem wie ihre im Rollstuhl sitzende Schwester Betina, die auf dem Niveau einer Vierjährigen stehengeblieben ist. Dafür kann Yuna wunderbar malen, die Kunsthochschule schafft sie in Rekordzeit und ihr Professor verhilft ihr auch zum bitter nötigen wirtschaftlichen Erfolg – denn alle Familienmitglieder im argentinischen La Plata in den 40er-Jahren sind arm. In ihrer kleinwüchsigen Cousine Petra, die dem „ältesten Gewerbe der Welt“ nachgeht, findet sie eine – allerdings sehr problematische –Freundin. Denn Petra rächt sich an dem Mann, der ihre Schwester geschwängert hat, die dann an den Folgen einer illegalen Abtreibung stirbt, auf grausame Weise. Männer sind in Venturinis Argentinien entweder abwesend – wie Yunas Vater, der die Familie verlassen hat – oder Frauenschänder. Der so hilfreiche Kunstprofessor schreckt schließlich nicht einmal vor der schwerbehinderten Betina zurück. Und Petras Kunden verpassen ihr ständig blaue Flecken.
Venturini erzählt die vielen unglaublichen und manchmal ziemlich ekeligen Geschichten inklusive Mord, Abtreibung und erzwungener Hochzeit konsequent in den Worten der sehr einfachen und naiven Yuna, die sich mithilfe eines Wörterbuchs eine komplexere Ausdrucksweise aneignen will. Kommas fehlen meist. Dadurch bekommt der Roman eine geradezu gespenstische Unmittelbarkeit, sowie einen unwiderstehlichen Sog. Ein Sprachkunstwerk, das sich wie ein Krimi liest. Eine Entdeckung!

Aurora Venturini: Die Cousinen
Aus dem Spanischen von Johanna Schwering
dtv
192 Seiten
€ 23,70