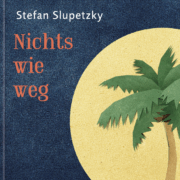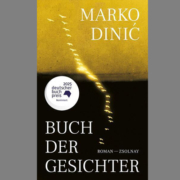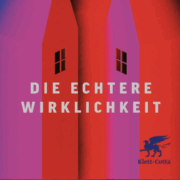Theater in der Plastikwelt – Zak Zarafshans Queer-Komödie „The Boys Are Kissing“ im Volkstheater
Willkommen in der Plastikwelt: Über die ganze Bühne zieht sich ein zum Rasen aufgeblasener Teppich und am Beginn schälen sich die vier Nachbarn aus ihren kleinen Luftpolsterhäuschen. Wir sind in einer britischen Kleinstadt, wo sich Admira und Cloe – anders als in London – ein Häuschen leisten können und mit Matt und Sarah nebenan das Kleinstadtidyll leben wollen. Hätten sich nicht ihrer beiden Söhne am Schulhof geküsst… Natürlich erinnert man sich da an Yasmina Rezas „Gott des Gemetzels“, wo eine Rauferei zwischen Buben dann bei den Eltern eskaliert.
Aber „The Boys Are Kissing“ des britisch-iranischen Autors Zak Zarafshan spielt geschickt mit Klischees und Regisseurin Martina Gredler sowie Sophie Lux (Bühne) und Moana Stemberger (Kostüme) haben dafür das perfekte optische und dramaturgische Setting gefunden. Die Figuren – auch zwei Engel und stumm auch die beiden Buben spielen mit – können problemlos hinfallen und wieder aufwippen, denn alles ist mit Luft gefüllt. Heiße Luft ist es schließlich auch, was die konservativen Wächter der Moral (Elternbeirat!) nach diesem Nicht-Ereignis am Schulhof von sich geben. Als dann plötzlich ein Geburtstagsfest, zu dem einer der beiden Freunde nicht willkommen ist in einem Desaster endet, droht sich das komplette Idyll in Luft aufzulösen. Die Szenen laufen dabei fast wie bunte TikTok-Videos ab. Für eine Komödie bekommen wir aber trotzdem ganz schön viel Konfliktpotential mit – das lesbische Paar kämpft ebenso mit sich kreuzenden Lebensentwürfen wie die Heteros mit ihren Vorurteilen. Als Helfer und Richter fungieren die beiden queeren Engel (Nick Romeo Reimann und Luca Bonamore), die zu Publikumslieblingen aufsteigen, zumal sie auch singen dürfen. Wirklich gut spielen aber sowieso alle. Das Premierenpublikum spendete zurecht den längsten Applaus seit langem im Volkstheater.
Foto: Marcella Ruiz Cruz
Infos & Karten: volkstheater.at