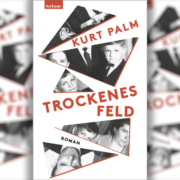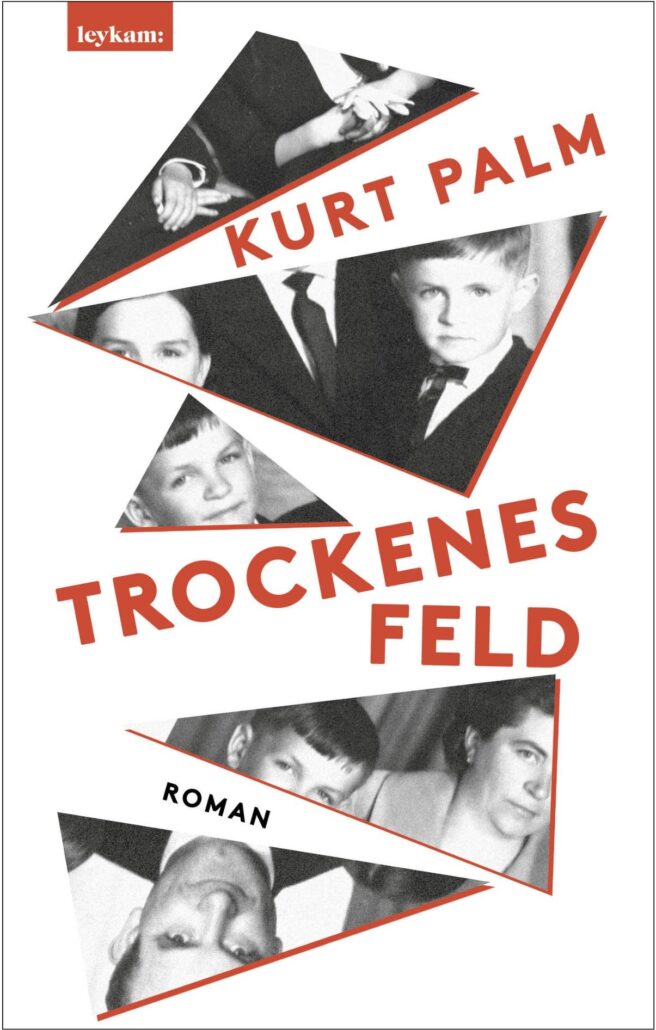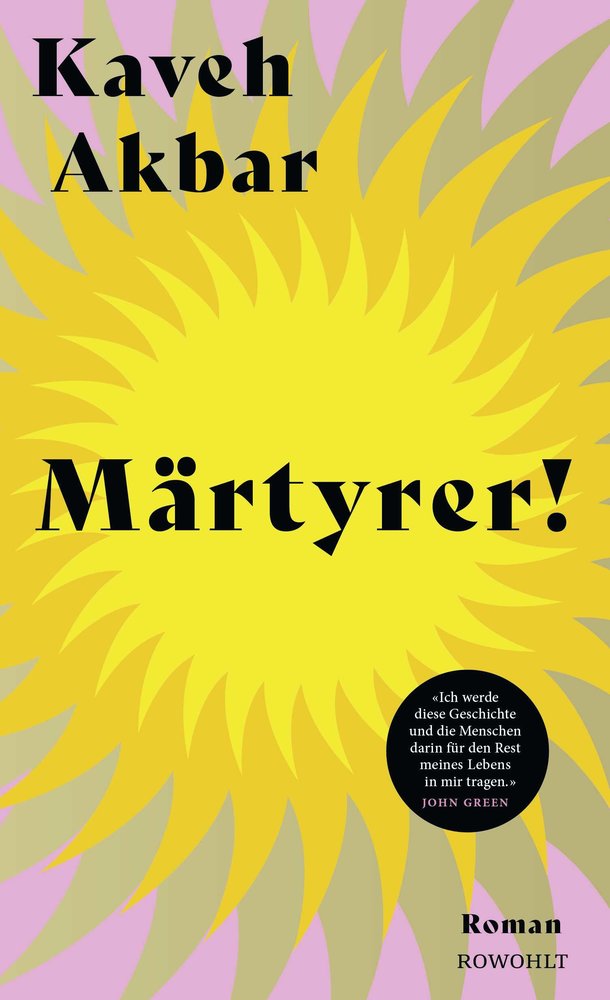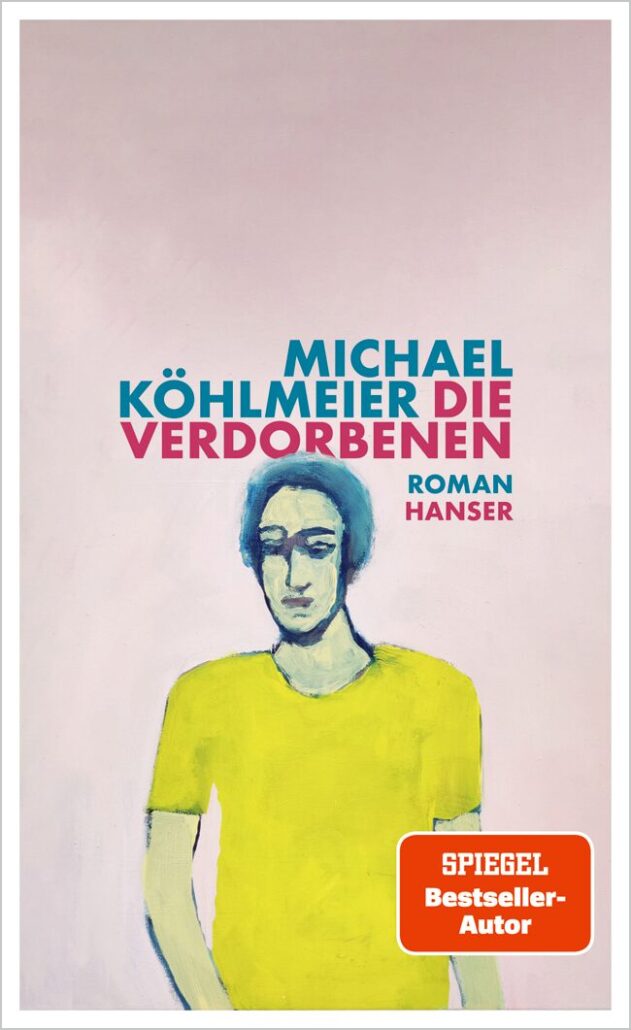Von Michael Schottenberg, gesprochen in der Galerie Suppan zur Eröffnung der Ausstellung am 4. März. | Foto: Peter und Susi Sengl. ©Willi Denk
Ich kenne einen Jongleur, der wirft sich einen kleinen Löffel auf die Stirn, und er bleibt stehen. Was für eine Umkehrung der Natur. Das Löffelchen widerspricht jeder Schwerkraft. Ich weiß nicht, weshalb das Leben manchen schwer fällt und manchen leicht. Der heute zu belobende Künstler ist einer, der in Permanenz Löffelchen auf seine Stirn wirft, und alle bleiben sie stehen. Er kann etwas, was sonst kaum einer kann. Er schmiegt sich quer durch alle Stilrichtungen, trotzt seit Jahrzehnten höchst erfolgreich jenen, die alles wissen und alles können und doch nicht den Mumm haben, herauszutreten aus dem Schatten der engen Gassen, wo sie als Nager überleben, immer die nächste Wade im Visier, um darüber herzufallen, sich zu ihr zu verbeißen und ihr Opfer zu Fall zu bringen, um so ihr eigenes Überleben zu sichern.
Peter Sengl ist und bleibt nicht zu übersehen. Auf dem Weg in sein Atelier, bei Premieren, Vernissagen, auf Unauffälliges wird verzichtet: Perfekt geschnittene Anzüge, Hingucker, sind sein Markenzeichen. Mal in sattem purpurrot, als wäre der Leibhaftige im Hause Gaultier auf einen kleinen Stepp vorbeigekommen. Mal in wellensittich-gelb-schwarzem Karo, als wäre er extravaganter Schrittmacher einer Tanzformation im Sambadrom zu Rio. Peter Sengl ist wandelnde Haute Couture. Die Anzugfarben findet man übrigens auch in seinen Rückzugsorten wieder. Obwohl: Die Grundfarbe seiner Bilder ist zumeist Rot.
Kleiderbewusstsein besaß der Halbwüchsige schon in der Mittelschule in Graz. Oder sollte es heißen: Der Fetisch „besaß ihn“? Tatsächlich hat es etwas von Besessen-heit, die ihn von klein auf gefangen hält. Im Laufe der Jahre hat Sengl sich als eigene Kunstfigur erfunden. Nicht nur in vorzugsweise asiatischen Lokalen lümmelt er nachlässig hingegossen, mit übereinander geschlagenen Beinen herum. Auch auf seinen Bildern tut er es. Er „besitzt“ sie, im wahrsten Sinne des Wortes. Zwischen nackten Frauen, dämonisierten Gestalten oder in nachgemalten Vorlagen berühmter Malerkollegen. Da hockt er dann und kennt kein Pardon. Wo Sengl rein will, kommt Sengl auch rein. Und ist er dann drin, werden die Sujets, garniert mit seiner ihm eigenen Skurrilität, nur noch surrealer – und die Aschenbecher voller. Er raucht die dünnsten Kippen der Welt. Sengls Begeisterung für filigrane Zigarettensorten ist legendär. So schmal sind sie, dass man sich erstens fragt, wo er sie um Himmels Willen herhat und zweitens, ob es sich überhaupt lohnt, sie anzustecken. Ohne Humor und hochkonsequent arbeitet er an ihrer Vernichtung. Voller Geringschätzigkeit schnippt er die Asche von sich, als gelte es sie zu demütigen. Wie einem Ritual folgend lässt er unmittelbar darauf sein schönes Ronson-Feuerzeug zwischen den Fingern erscheinen und zündet, nachdem die halb gerauchte Kippe in schönem Schwung im Aschenbecher landet, erneut eine der Superschlanken an, um das laszive Spiel genussvoll von Neuem zu beginnen.
Peter Sengl, du „Maß-Schneider in eigener Sache“, wie du einmal liebevoll genannt wurdest, du Dandy-Raucher, du spitzbübischer Überlebenskünstler, du Gesamtkunstwerk, du achtzigjähriges, lass dich feiern heute – umgeben von deinen Werken, deinen Freunden und all denen, die dich beneiden. Denn davon sind einem Jeden jede Menge zu gönnen.
Wir beide kennen einander aus der Klingklang-Zeit zu Ende der grauen 1970er, als Hans Gratzer Wien mit einem neuen Kultort nachhaltig veränderte: das Schauspielhaus. Dort stand nächtelang, jahrelang ein Paar an der Bar – sie, eine prachtvoll erotische Frauensperson, schön und malenswert, er, ein aufsehen-erregender Mensch in grellbunten Anzügen, beide Gallonen von Weißwein vernichtend – ein Paar, wie von einem anderen Stern. Ich war damals ein gertenschlankes, unerfahrenes, halbhübsches Wesen, das seine ersten Schritte auf eben dieser Bühne tat, die Sengls waren stadtbekannte glamouröse Künstler, die sich mir auf der Netzhaut einbrannten. Auch nur ein einziges Bild von ihnen zu besitzen war der unerreichbare Wunsch meiner frühen Jahre. Es sollten zwei werden. Sengl schenkte mir eines, und verkaufte mir ein anderes. Immer noch hüte ich sie wie einen Schatz, trotzdem noch weitere, in eben diesem Verhältnis dazugekommen sind. Peter Sengl ist gleichermaßen unerreicht großzügig, wie nachvollziehbar geschäftstüchtig.
Auch später, lange nach dieser Pionierzeit, haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt, ziemlich oft sogar. Umso mehr freue ich mich, dass ich hier im Rahmen dieser opulenten Ausstellung anlässlich deines unaussprechlichen Geburtstages zu dir und über dich sprechen darf. Eines haben wir beide gemeinsam: Ich bin auf der Bühne geboren. Und du nicht weit davon entfernt, im Zuschauerraum. Damals liebtest du das Theater mindestens so wie ich. Was uns trennte, war die Rampe. Aber auch nur imaginär.
Deine Bilder nämlich sind hochtheatralisch. Sie haben etwas von Weltwunder-maschinen. Menschen werden von scheinbar höherer Macht verschraubt, vernietet, verkettet, mittels Halseisen zu Posen gezwungen, von Pfeilen durchpflockt, von Fauna und Flora umwachsen. Dies alles aber macht sie offensichtlich nicht leiden, im Gegenteil. Durch den Schmerz in einen schwerelosen Schwebezustand befördert, bewohnen sie eine postmodern-farbenfrohe Fortschreibung einer Welt die von Kubin, Seurat, Redon inspiriert scheint, und die von Sengl in eine hochglänzende Schule neuer Sinnlichkeit überführt wird – eine Welt die der Künstler seinen Geschöpfen verordnet und zu deren Mittelpunkt er selbst wurde. In Kompanie übrigens mit seiner wunderbaren Frau, Susanne Lacomb, die immer schon weit mehr war als bloß Muse. Selbst eine hochsensible Künstlerin, ihre gemeinsame Tochter Deborah, die dritte im Künstlerbunde, hat sie nicht umsonst einmal als „Konzeptkünstlerin der ersten Stunde“ bezeichnet, hat sie sich und ihr Leben dem Herrn Sengl verschrieben. Oder sollte es besser heißen: Sie haben einander gesehen, sich aneinandergeschmiegt, ineinander verschlungen, bis sie sich in einem unentwirrbaren Kokon ihrer selbst wiedergefunden haben. Beseelt von praller Lebensfreude bauen sie unentwegt an einer Welt voller Wunder und bewohnen sie selbst auch. Man möchte mit eintauchen in dieses verrätselte, anziehend elegante Unbewusste. Man sehnt sich geradezu danach, Teil einer Welt zu sein, die so postkartengrell verführerisch ist wie die Geschöpfe, die sie bewohnen – voller Leben und Erotik.
Sengls Werk und sein Lebensumgebungsstil lässt an Herzmanovsky-Orlando denken. Ihr habt eines gemeinsam: Die überbordende Anmutung verknüpft mit der Lust am Absurden. Dazu kommt noch das herrlich verkauzte Spiel mit Bildtitel, die in Ecken gekrakelt werden: „Sackaufbläser im Blumenkranz“, „Ein kleiner Anpumperer kann sich im Erdbeer-Nacht-Amphibien-Aufzuchtraum selbst an den Ohren in die Höhe ziehen“, „Tiermenschalpenwaldrebekasten“, oder „Schuhspitzenverlängerungs-tänzer“, wie du eines meiner Bilder benanntest. Oft allerdings ist die Gegenständlichkeit der Titel auf der Leinwand gar nicht mehr sichtbar. Der Künstler hat die Lust daran verloren – und hat sie übermalt.
Und dann noch die Unmenge an Bildern in deinem Atelier! In Regalen, Schubläden, an den Wänden, in allen Ecken, an allen Enden hängen, stehen, lehnen und lagern sie. Wie zum Leben erweckte Zeugen innerer Umtriebigkeit und nicht enden wollender Energie. Und immer griff- und servierbereit: Die gut gekühlte, frostbeschlagene, in Flaschen abgefüllte Lebensfreude. Weißburgunder, Rotgipfler, Welschriesling. Dazwischen überall und unübersehbar – die Menge überfüllter Aschenbecher.
Für mich bist du ein aus der Barockzeit herüber geretteter Mensch mit großer, unzerstörbarer Lust am Leben, immer auch im Bewusstsein deiner Endlichkeit. Du bannst den Tod, indem du ihn malst, festschraubst, fixierst. Und diesem Bild gibst du den Titel: „Der Tod ist schwarz, gelb, blau und rot, dennoch ist der Tod nicht tot.“ Das hat etwas trotzig-anarchisches, zugleich auch konservativ-religiöses an sich. Nicht von ungefähr. Sengls Vater war Pfarrer und Beichtbeauftragter seiner ursprünglichen Familie. Ein liebenswertes, Tartuffe’sches Wesen. Er hatte Peters Mutter in einem Cabrio das Chauffieren beigebracht. Die Lektion endete in gegenseitiger Annäherung. Das ansehnliche Ergebnis war Peters älteste Schwester. Für den neuen Herrn Papa bedeutete dies aber auch gleichzeitig das Ende der Soutane. Hinter vorgehaltener Hand wird erzählt, dass der kleine Peter in Unterbergla, in der Weststeiermark, in einer Gemischtwarenhandlung zur Welt kam – auf einem Mehlsack (nach abermaliger Cabrio-Lektion). Es könnte sein, dass dies in späteren Jahren zu einer Phobie geführt hat. Mails zu beantworten ist nicht seins. Auch WhatsApp lehnt er ab. Da bleibt er stur. Er bevorzugt das Gespräch. Bei einem wohl temperierten Glas Wein.
Peters Sengls Geheimnis um die Leichtigkeit des Löffelchens kann ich mir immer noch nicht erklären. Aber wie ein guter Zauberer seinen besten Trick nicht verrät, nimmt Sengl sein Geheimnis in sein verwunschenes Atelier mit und heißt die Welt einen Narren.
Als Senglerianer alter Schule darf ich mich im Namen aller im Klub Befindlichen bei der Direktion des Hauses bedanken. Peter, ich wünsche dir noch eine Menge Löffel auf die Stirn und Ihnen, verehrte Damen und Herren danke ich für die Aufmerksamkeit – wissend, dass ich weder Kunstexperte bin, noch mich dazu berufen fühle, Sengls Werk zu kommentieren. Nichts anderes hatte ich im Sinn, als ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn auch aus einem Jahrzehnte alten – aus Bewunderung meinen allerbegabtesten Freunden gegenüber. Ich verwende die Mehrzahl. Täte ich es nicht, ich würde denen, die denselben Namen tragen, nicht gerecht werden. Denn es ist eine dreifaltige, faltenfrei verschworene Einheit: Die Löffelchen werfenden Sengls.
Die Ausstellung „Peter Sengl – Sein Universum zum 80iger“ ist in der Galerie Martin Suppan, Palais Coburg, Seilerstätte 3C, 1010 Wien bis 22 April nach Vereinbarung zu sehen: suppanfinearts.com