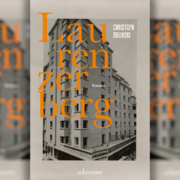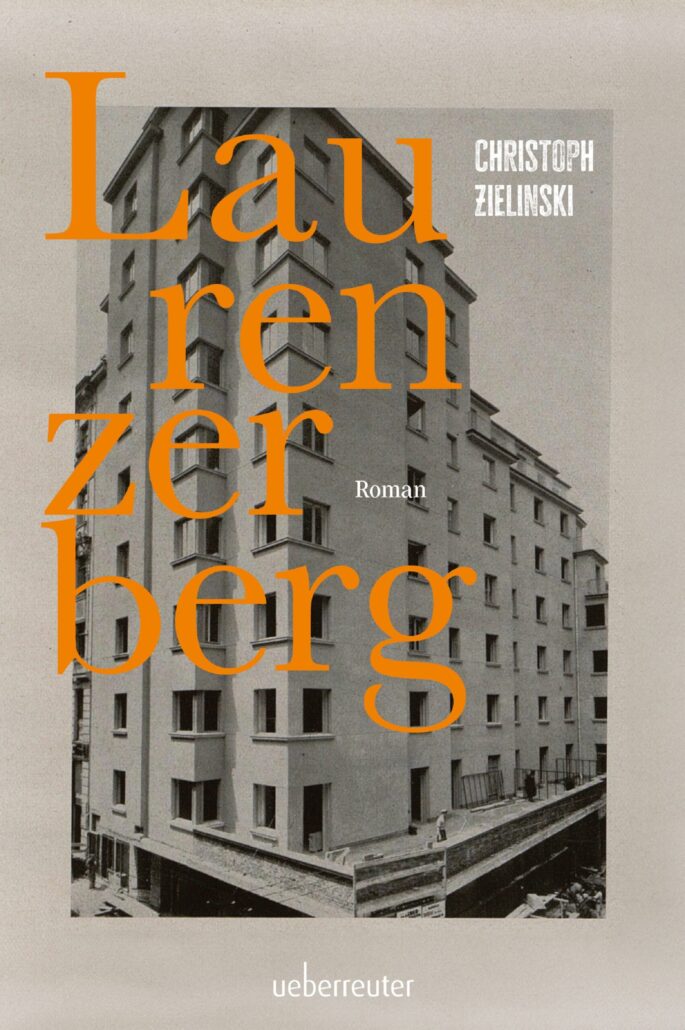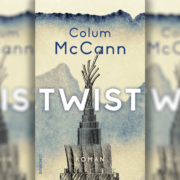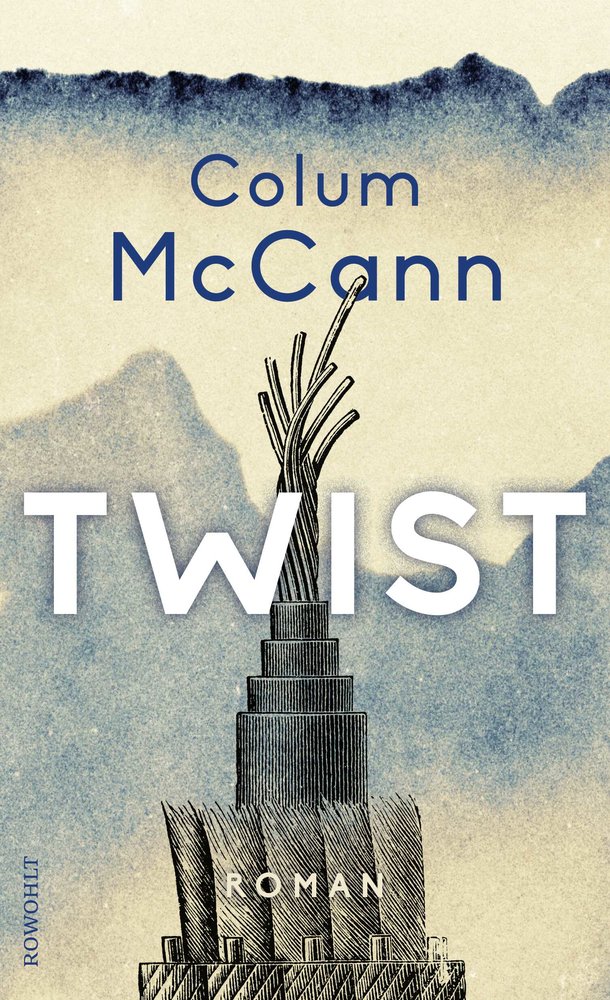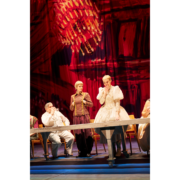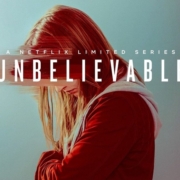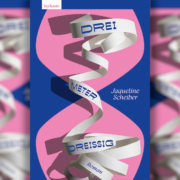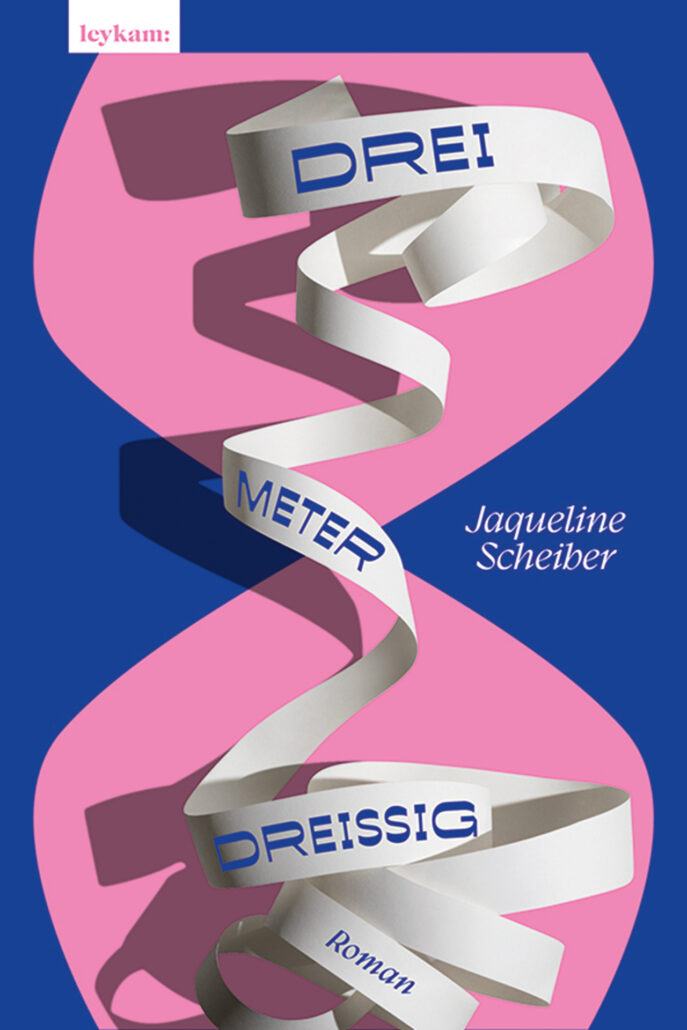„Café Creativ“ mit dem Informatiker & Physiker Werner Gruber
In der vierten Ausgabe der beliebten Diskussionsreihe der Wirtschaftskammer Wien – Sektion Werbung und Marktkommunikation – und Wienlive sprach der Physiker und Informatiker Werner Gruber über Möglichkeiten von KI und die Auswirkungen auf die Geopolitik. Gruber, bekannt aus diversen TV-Sendungen („Science Busters“, „Experimentalküche“) sowie populärwissenschaftlichen Bestsellern verblüffte das Publikum im vollen Café Landtmann mit Beispielen, was die KI schon heute zu leisten imstande ist. In der Moderation durch Helmut Schneider, Chefredakteur von Wienlive, erzählte Gruber wie er schon in den 90er-Jahren an der Uni Wien daran arbeitete, ein menschliches Gehirn zu simulieren, um etwa ein Phänomen wie das Stottern zu verstehen. Heute gelingt es KI-Programmen, innerhalb kürzester Zeit wissenschaftliche Arbeiten zu erstellen, die fast fehlerfrei sind. Nach seinen Ausführungen diskutierte Gruber dann noch sehr lange mit interessierten Gästen des Café Creativ über selbstfahrende Autos, die revolutionären Erfolge von KI in der Medizin, die globale Chipproduktion oder ein bedingungsloses Grundeinkommen als Folge der kommenden Automatisierung.
„Café Creativ“ verbindet die legendäre Wiener Kaffeehauskultur mit aktuellen Themen aus Werbung, Marktkommunikation und Medien. Die neue Veranstaltungsreihe bietet eine exklusive Plattform für Impulsvorträge, spannende Diskussionen und wertvolles Networking. In der Tradition der großen Wiener Denker und Praktiker aus der Welt der Marktforschung und Kommunikation – wie Ernst Dichter, Paul Lazarsfeld und Maria Jahoda – lädt das „Café Creativ“ zu einem Dialog, der nicht nur intellektuell anregend, sondern auch gesellig und inspirierend ist. Gäste erwartet eine einzigartige Atmosphäre, die den Austausch von Ideen und Perspektiven fördert – begleitet von Wiener Schmäh und einer Auswahl an exquisiten Kaffeehaus-Schmankerln.
In der nächsten Folge wird am 13. Mai die Philosophin Lisz Hirn über Philosophie als Hilfe für Wirtschaft und Management sprechen (Café Landtmann, 18 Uhr).