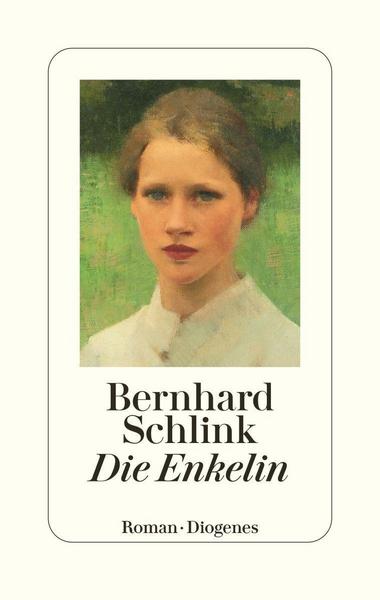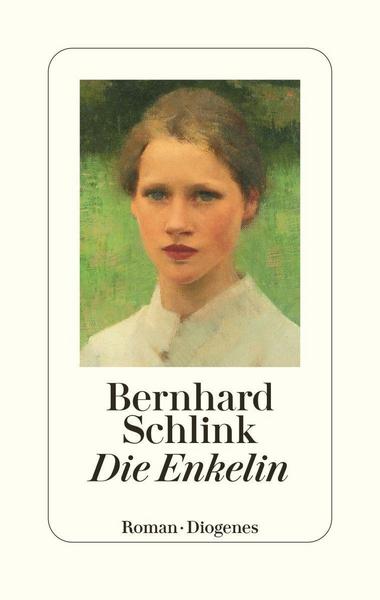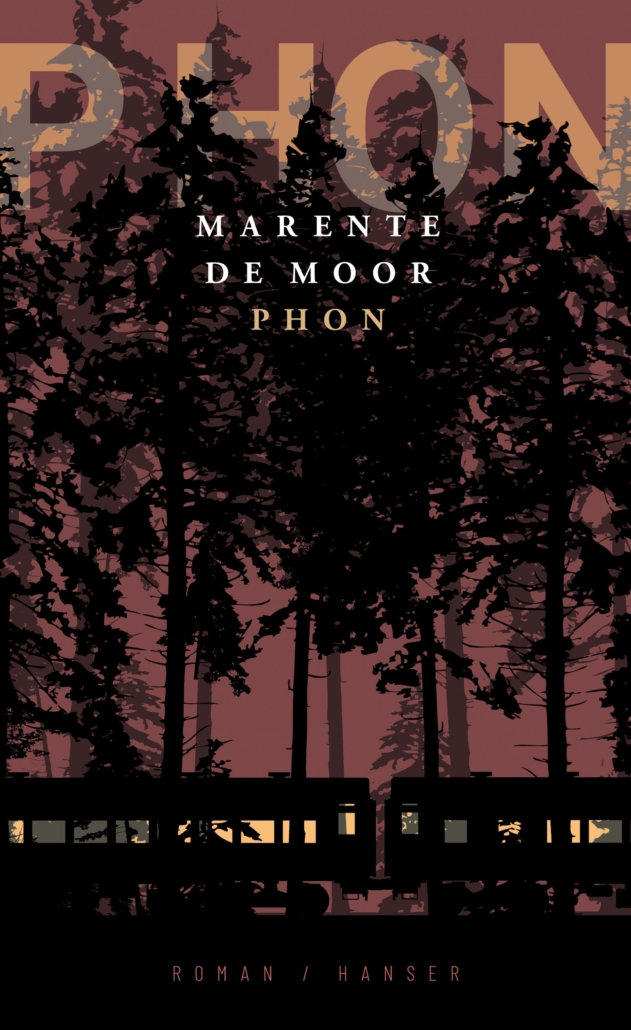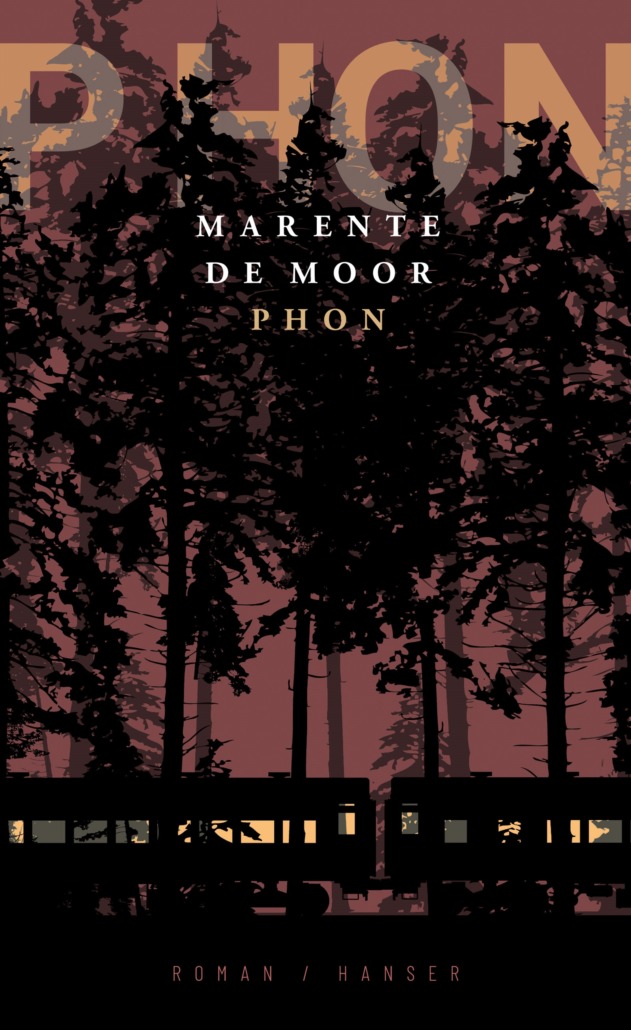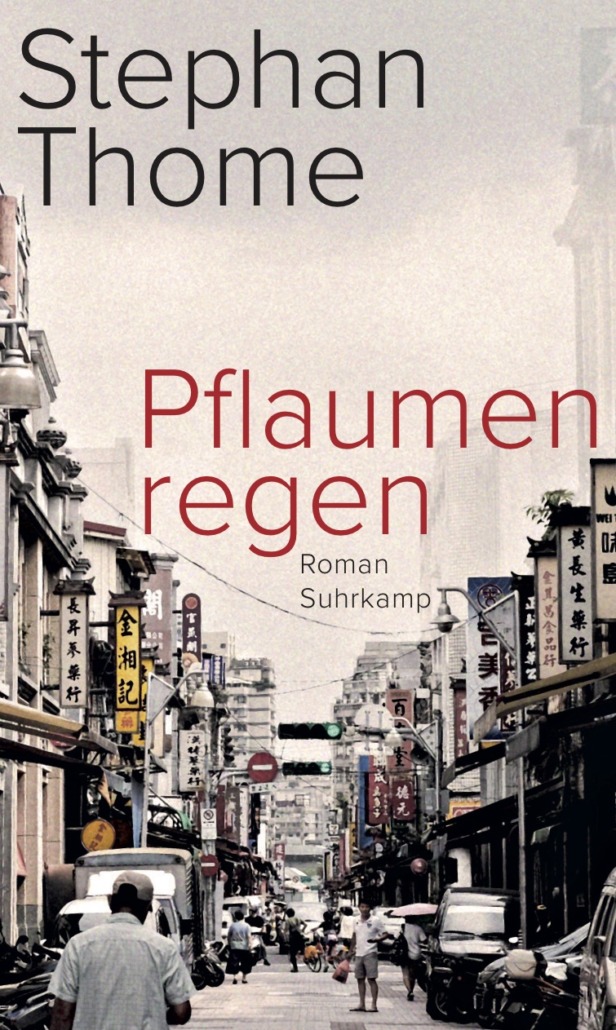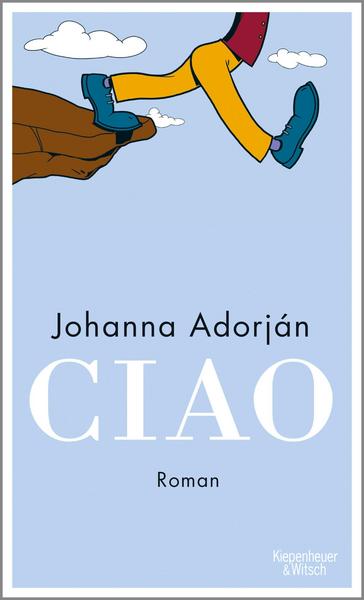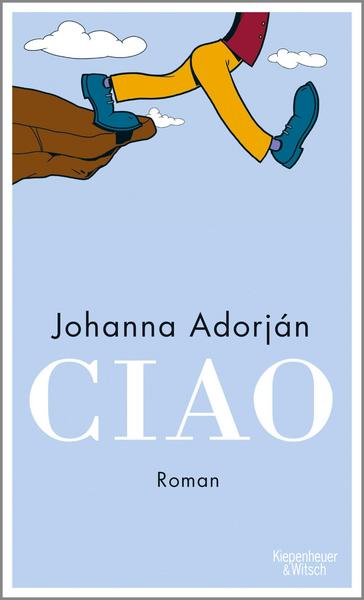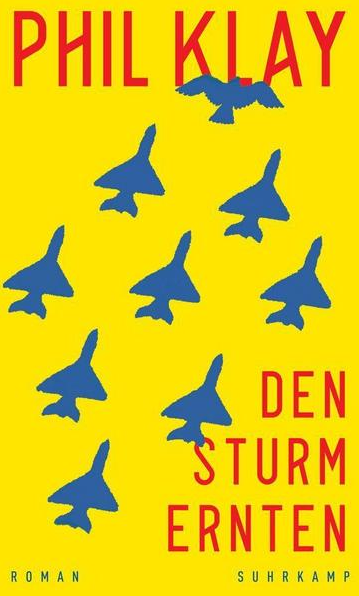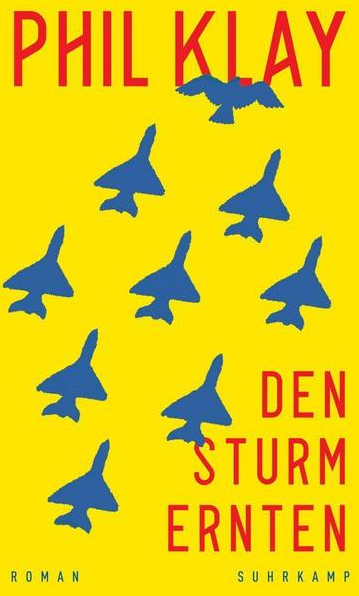Buchtipp – Yaa Gyasi, Ein erhabenes Königreich
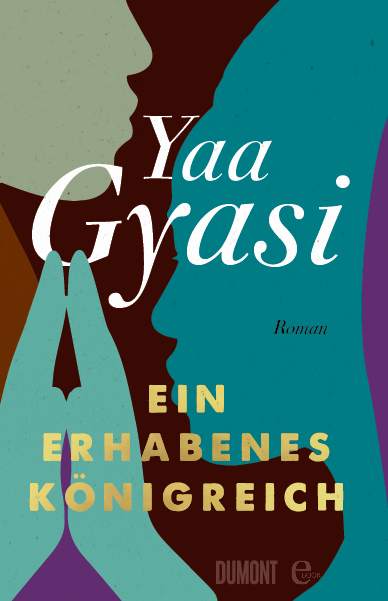
Zwischen Afrika und USA
Yaa Gyasi: „Ein erhabenes Königreich“. Ein Buchtipp von Helmut Schneider.
In einem Labor in Stanford macht Gifty Mäuse süchtig und untersucht für ihre Promotion dann jene, die das Suchtmittel auch dann noch haben wollen wenn sie dafür einen Stromschlag riskieren müssen. Aus einer aus Ghana eingewanderten Familie stammend hat Gifty es geschafft – immer Bestnoten schon in ihrer Schule in Alabama, Studium in Harvard und dann weiter nach Stanford. Aber der Preis war hoch, Gifty kann nicht gut mit anderen Menschen, als Jugendliche geht sie voll in der evangelikalen Kirche auf, die sie praktisch von einem Tag auf den anderen mit der Wissenschaft tauscht. Die emotionale Kälte hat sie von ihrer Mutter geerbt, die – nachdem der Vater wieder zurück nach Ghana gegangen ist – zwei Jobs braucht, um die Familie halbwegs über die Runden zu bringen. Und dann ist da noch ihr geliebter Bruder Nana. Der Mädchenschwarm und Basketball-Star wird nach einem Sportunfall Opfer der Opioid-Krise. Er gewöhnt sich rasend schnell an die ofiziell zugelassenen Schmerzmittel und wird wie viele tausende andere – in den USA sollen 450.000 Menschen dadurch umgekommen sein – abhängig. Schließlich steigt er auf das billigere Heroin um und stirbt an einer Überdosis.
Yaa Gyasi wurde zwar 1989 in Ghana geboren, wuchs aber schon in den USA auf. Sie wurde 2016 mit ihrem ersten Roman „Heimkehr“ bekannt, der bereits mehrere Preise abstaubte. „Ein erhabenes Königreich“ umfasst mehrere Themen wie den Rassismus in den USA, Religion und Wissenschaft oder Drogen, ist im Kern aber ein migrantischer Familienroman. Besonders eindringlich wird Giftys Mutter beschrieben. Die hart arbeitende Migrantin versäumt keinen Gottesdienst, unterstützt die Kirche wo immer möglich und wird dabei doch immer als Außenseiterin behandelt. Nach dem tragischen Tod Nanas verfällt sie in eine tiefe Depression und verlässt monatelang nicht ihr Bett. Als Gifty dann in Stanford arbeitet, hat sie einen weiteren Schub und legt sich bei Gifty völlig antriebslos ins Bett. Ahedonie nennt das die Wissenschaftlerin, die sich manchmal wünscht, sie könnte mit optisch-elektrischen Hilfsmitteln wie bei ihren Mäusen direkt das Gehirn ihrer Mutter stimulieren.
Als Kind schrieb Gifty ihr Tagebuch direkt an Gott gewandt. So bringt sie Ordnung in ihr verwirrendes Leben. Das Arbeiten als Forscherin fällt ihr dann leicht, es gelingt ihr bereits als Studentin in wissenschaftlichen Magazinen zu veröffentlichen. Gyasi schafft es dabei, uns sowohl für Religion als auch für Forschung zu interessieren, ihr Roman ist ein sehr gelungenes und sehr gut lesbares Porträt einer jungen Frau mit problematischer Vergangenheit.
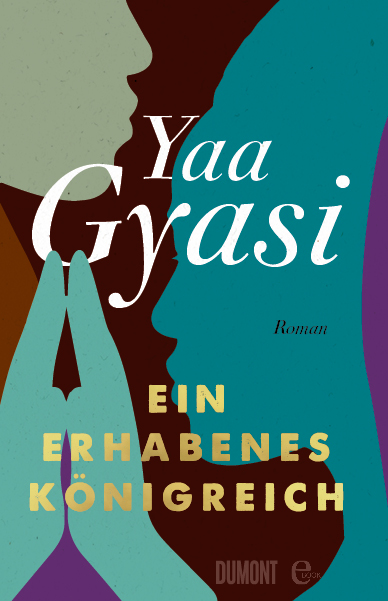
Yaa Gyasi: Ein erhabenes Königreich
Aus dem Englischen von Anette Grube
Dumont Verlag
ISBN: 978-3-8321-8132-1
302 Seiten
€ 22,95