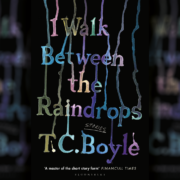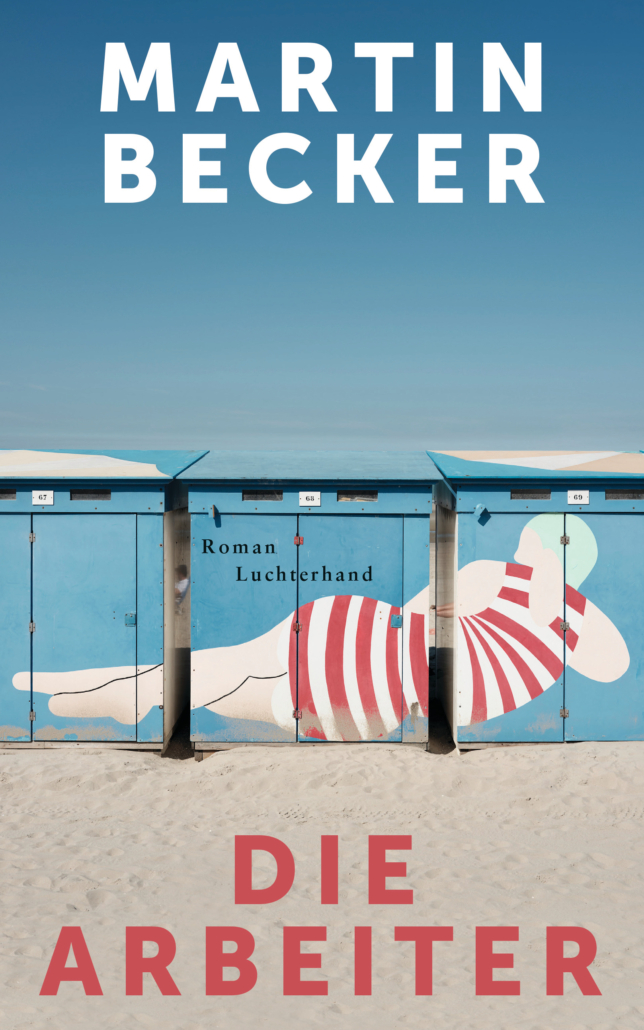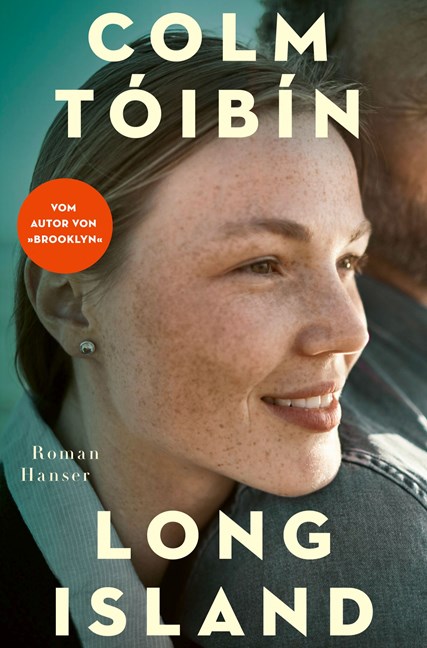13 neue Kurzgeschichten vom Meister – T.C. Boyle „I walk between the Raindrops“
Kurzgeschichten haben es bei uns noch immer schwer. Die meisten, die sich überhaupt für Literatur interessieren, lesen lieber Romane. Möglicherweise weil Stories schwieriger zu konsumieren sind, denn man muss sich in jeder Geschichte erst zurechtfinden – wer ist der „Held“?, wo spielt das Ganze und in welcher Zeit? Das mag in den USA nicht anders sein, aber dort hatte man immerhin lange Zeit Magazine, die regelmäßig Kurzgeschichten servierten. Der Markt ist kleiner geworden, aber die höhere Achtung für Short Stories ist geblieben. Und so überrascht es nicht, dass die aktuellen Meister dieses Genres aus den USA kommen. T.C. Boyle gehört zweifelsohne dazu, wobei das deutsche Publikum nur einen Bruchteil seines tatsächlichen Outputs kennen.
13 Stories bringt Hanser jetzt heraus, die die Vielseitigkeit seine Oeuvres wieder einmal beweisen. Da machen wohlhabende Kalifornier in einem kleinen Ort in Arizona Bekanntschaft mit dem seltsamen Personal einer Bar. Zwei Welten treffen aufeinander. Eine Geschichte spielt in der Zukunft, wo selbstfahrende Autos auch gegen den Willen ihrer Besitzer entscheiden, wer einsteigen darf und in einer anderen sind wir beim Ausbruch einer Pandemie auf einem Kreuzfahrtschiff. Diese Story hat Boyle geschrieben, als wir von Corona noch so gut wie gar nichts wussten. Das Thema ist aber sowieso, wie sich Menschen verhalten, die auf engstem Raum tagelang quasi eingesperrt werden.
Boyle kann das nämlich perfekt, mit wenigen Sätzen eine Stimmung erzeugen und Personen so knapp beschreiben, dass ihre Handlungen glaubhaft werden. Und er schert sich wenig um die sogenannte political correctness. Am College haben fast gleichaltrige Lehrerinnen und Schüler sexuelle Beziehungen – ein Minenfeld fürwahr, aber dem Autor geht es nicht um Moral, sondern nur um die persönlichen Erfahrungen seiner Protagonisten. Wir sind ja in der Literatur und nicht in einem Gesetzesentwurf. Boyle liebt es auch, Unerwartetes zu bringen – in einer Geschichte sind wir etwa in Frankreich nach dem Weltkrieg, als eine Mutterkorn-Vergiftung einem ganzen Dorf Horror-Halluzinationen verschafft. Lustiger ist die Geschichte, in der selbsternannte Führerinnen Menschen 50 Dollar abknöpfen, damit sie für 2 Stunden im Wald vor der Haustüre allein sein können. Eine echte, schmerzhafte Begegnung mit der Natur erfährt ein Teilnehmer aber erst, als eine Klapperschlange in seinem Vorgarten auftaucht.
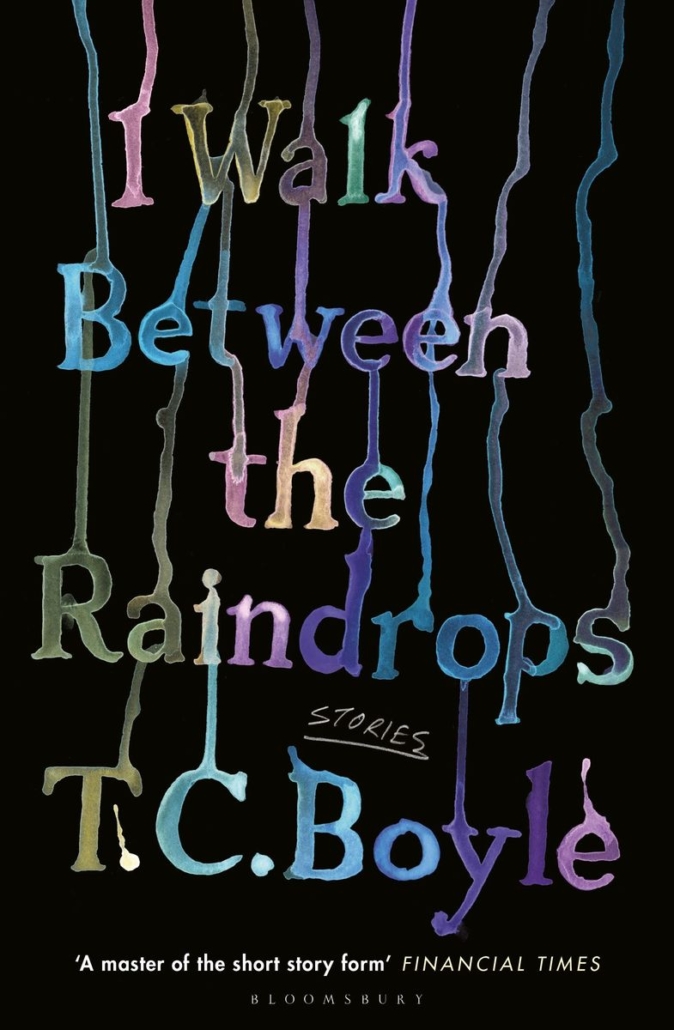
T. C. Boyle: I walk between the Raindrops. Stories.
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren und Anette Grube
Hanser
274 Seiten
€ 26,50