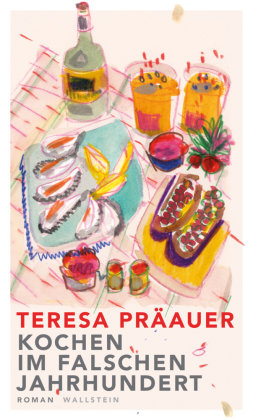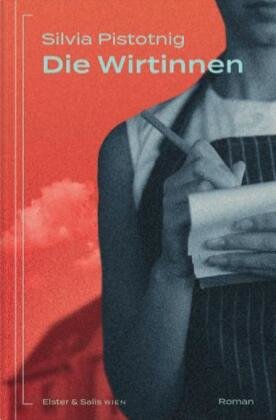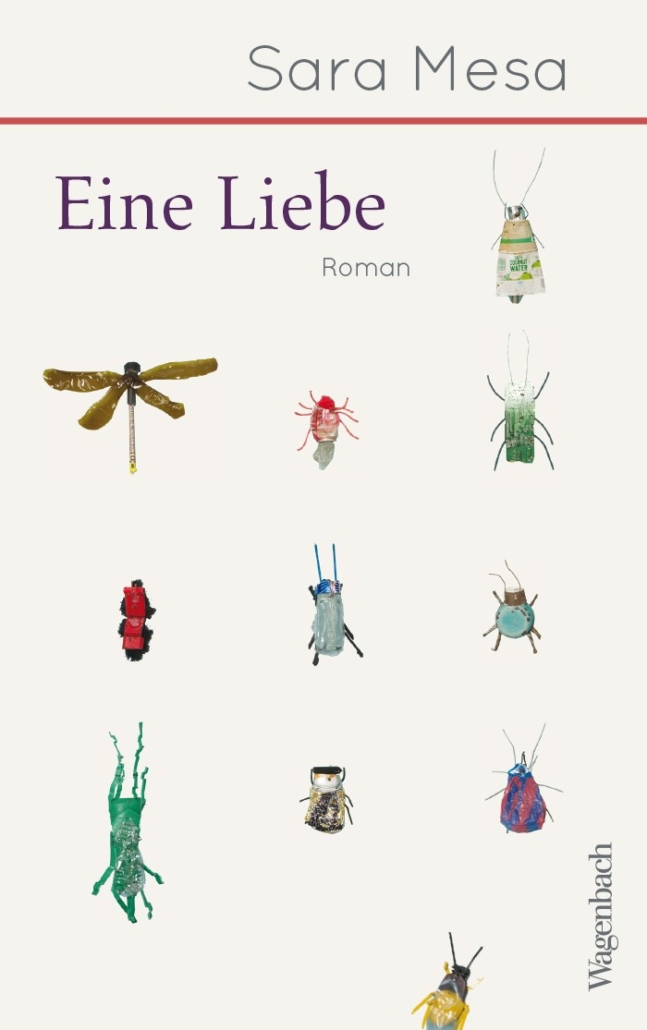Moritz Eggerts Operette „Die letzte Verschwörung“ an der Wiener Volksoper
Bild: ©Barbara Pálffy
Wer sagt denn, Musiktheater sei antiquiert und bringe immer nur dieselben alten Stoffe? Die Volksoper will den Gegenbeweis antreten. Ihre Chefin Lotte de Beer gab dem Komponisten und Librettisten Moritz Eggert den Auftrag zu einer Operette – dem antiquertesten Genre überhaupt – zum vieldiskutierten Thema „Verschwörungstheorien“. Und der hat prompt und – wie die Premiere zeigte – auch zum Gefallen des Publikums geliefert. Ein zweieinhalbstündiger (mit Pause) musikalischer Spaß, der auch intellektuell nicht unterfordert.
Wir erleben den Fall des beliebten Fernsehmoderators Friedrich Quant (Timothy Fallon), der ausgerechnet nach dem Auftritt eines Spinners, der behauptet, die Erde wäre eine Scheibe, an seiner eigenen Weltanschauung zu zweifeln beginnt als dieser ihm nachkolorierte Urlaubsbilder von Quants Familie zeigt. Wie der „Schwurbler“ (Orhan Yildiz) das macht, wird nicht ganz klar, allerdings zerfleddert Quants Glaube an die Tatsachen von da an an allen Enden. Reptilienmenschen haben die Kontrolle übernommen, das FBI sowieso und bald schon schauen Außerirdische vorbei, während in der Küche der Pizzeria Kinder als Belag aufbereitet werden. In den Videoeinspielungen regnet sowieso schon die Matrix runter vom Schirm – Quant verliert Familie und findet unter den Mitkämpfern eine Geliebte (Lara: Rebecca Nelsen), die sich freilich am Ende als nicht menschlich herausstellt. Moritz Eggert hat nicht viel ausgelassen, was es so an Humbug im Netz gibt – als der Bundeskanzler mit der sagenhaft reichen Mobilfunk-Sponsorin kuschelt, wachsen beiden Stacheln und Scheren. Dazu gibt es flotte, in Ansätzen sogar schlagertaugliche Musik, bisweilen erinnert der Soundteppich auch an Film. Intergalaktisch tanzen Menschen in silberglänzenden Vollkörperkostümen dazu.
Bevor das alles völlig entgleitet, kommt Regisseurin Lotte de Beer am Ende höchstpersönlich auf die Bühne und fordert bei dieser „Probe“ eine realistischere Darbietung. Ein Hinweis darauf, dass sich das Genre selbst nicht ernst nimmt. Viel Applaus für den kurzweiligen Abend.
Infos & Karten: volksoper.at