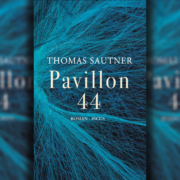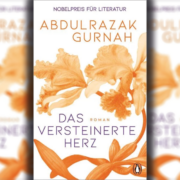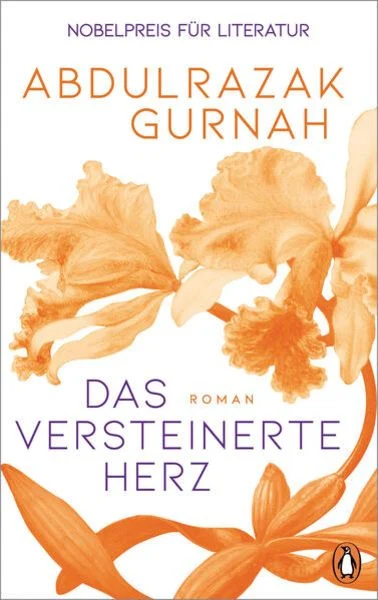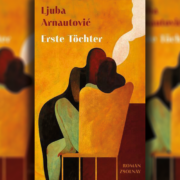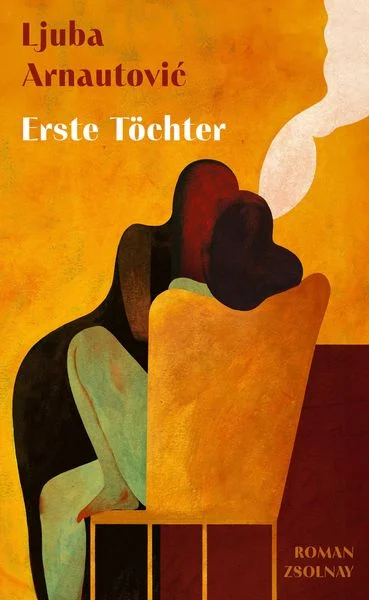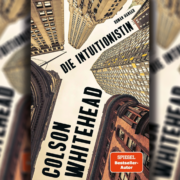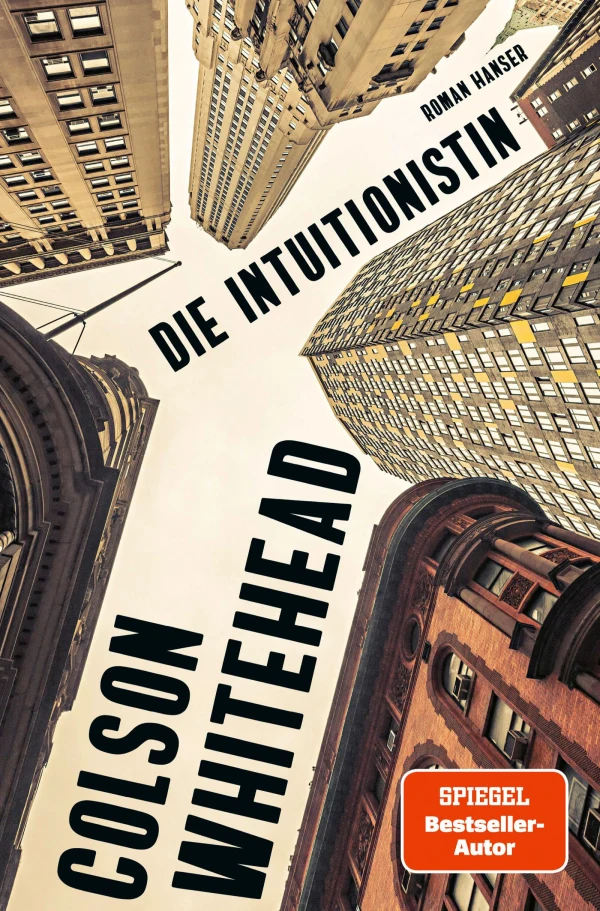In Steinhof stellt man sich Fragen über das Leben – Thomas Sautners „Pavillon 44“
Ein Mann, der sich für Jesus hält und Gottvater sucht, eine Greisin, die klüger ist als der Primar, eine junge Wut-Patientin und Dimsch, der mit seinem verstorbenen Freund redet – im Pavillon 44 kommen nur die interessantesten Fälle des psychiatrischen Krankenhauses, denn Primarius Lobell hat schon lange „Narrenfreiheit“, weil er ein persönlicher Freund des Wiener Bürgermeisters ist. Dabei ist er selbst seit Jahren von Psychopharmaka abhängig. Als sich Jesus und Dimsch für einen Tag aus dem Krankenhaus verdrücken, droht das System zusammenzubrechen – zumal Lobell gerade an diesem Tag vom Bürgermeister in einem Beisl mit Wein abgefüllt wird.
In Thomas Sautners opulenten Roman „Pavillon 44“ wird Steinhof und eigentlich ganz Wien zu einem psychologischen Grenzfall. Der in Wien und Niederösterreich lebende Autor psychologisiert sogar den eigenen Stand, indem er eine Schriftstellerin dort einquartiert, die für ihre Arbeit recherchiert und die natürlich selbst bald professionelle Hilfe zu brauchen scheint.
Das ist alles sehr unterhaltsam, wenngleich nicht immer originell. Sautner scheint bisweilen selbstverliebt in seinen Erzählstil. Aber er geht auch sehr sorgfältig mit seinem Personal um. Sogar der Busfahrer, der die Ausreißer in die City bringt, wird von Sautner liebevoll porträtiert. Und bei der Diskussion was denn eigentlich normal und was psychisch krank ist kann sich der Autor voll entfalten. In langen Spaziergängen um die eindrucksvolle Kirche am Steinhof von Otto Wagner diskutieren der Primar und die Schriftstellerin über Gott und die Welt. Auch ein karrieresüchtiger junger Nebenbuhler von Lobell, der alles mit Psychopharmaka für heilbar hält, darf nicht fehlen. Ein quasi philosophischer Roman für einige vergnügliche Lesestunden.
Thomas Sautner liest am 8. Oktober, 19 Uhr, in der Buchhandlung Seeseiten in der Seestadt aus seinem Roman.
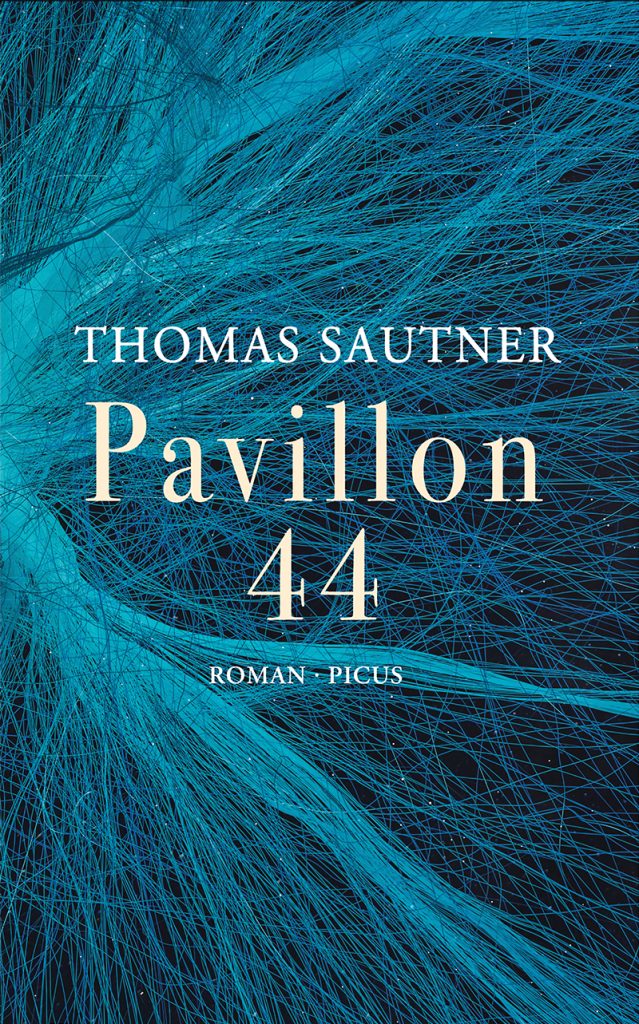
Thomas Sautner: Pavillon 44
Picus Verlag
458 Seiten
€ 27,-