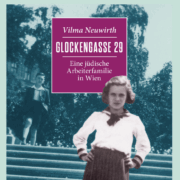„Nichts“ passiert – Percival Everetts unterhaltsamer Pop-Kultur-Krimi „Dr No“
Es gibt Dinge, die liegen jenseits unserer Vorstellung. Das Universum ist vor 13,8 Milliarden Jahren aus dem Urknall entstanden. Aber was war davor? Die wissenschaftliche Antwort, dass erst mit dem Urknall die Zeit entstanden ist und daher die Frage nach dem Davor sinnlos ist, kann unser im Endlichen gefangenes Denken natürlich nicht begreifen. Genauso wenig können wir uns das Nichts vorstellen. Und um das Nichts geht es in Percival Everetts höchst spannenden Roman in James-Bond-Setting „Dr No“. Denn Wala Kitu ist Professor für Mathematik an der renommierten Brown University und Experte für nichts. Als ebensolcher erhält er von einem reichen Exzentriker namens Sill, der beschlossen hat, sich als Schurke auszuleben, 2 Millionen Dollar überwiesen, damit er ihm als Experte für nichts dabei hilft. Sill, der wie Kitu eine schwarze Hautfarbe hat, musste vor seinem Reichtum reichlich Rassismus erleben und will sich jetzt rächen. In Ford Knox sollen nämlich nicht nur die Goldreserven der USA lagern, sondern auch eine Box, in der sich nichts befindet. Denn nichts hat angeblich die Power alles verschlingen zu können.
Wir sehen schon, Everett leistet sich den unendlichen? Spaß, mit nichts zu jonglieren und Sätze mit mehrdeutigen Aussagen zu schaffen. Leser werden mindestens alle 10 Seiten verblüfft. Aber „Dr No“ ist trotzdem ein veritabler Krimi samt Liebesgeschichte, denn eine Kollegin ist bald schon mit von der rasanten Partie, die an mehreren abenteuerlichen globalen Standorten abläuft. Sill gelingt es mithilfe von nichts eine Kleinstadt im Nordosten der USA auszulöschen, in der er vor Jahrzehnten rassistisch beleidigt wurde. Nichts bleibt übrig, denn alle, die die Stadt gekannt haben, können sich an nichts erinnern.
Everett liefert Schusswechsel und Exekutionen, denn natürlich sind ihm die Geheimdienste auf den Spuren. Der Autor wollte sicher auch beweisen, dass er neben dichten Romanen zum Thema Rassismus – im letzten, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman „James“ erfindet etwa die Nebenfigur Jim in „Huckleberry Finn“ die Geschichte neu – auch unterhaltsame Krimis schreiben kann. Nun, es ist ihm zweifelsohne gelungen!
Percival Everett: Dr No. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Hanser, 320 Seiten, € 26,80




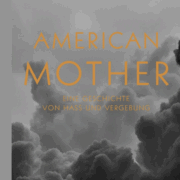

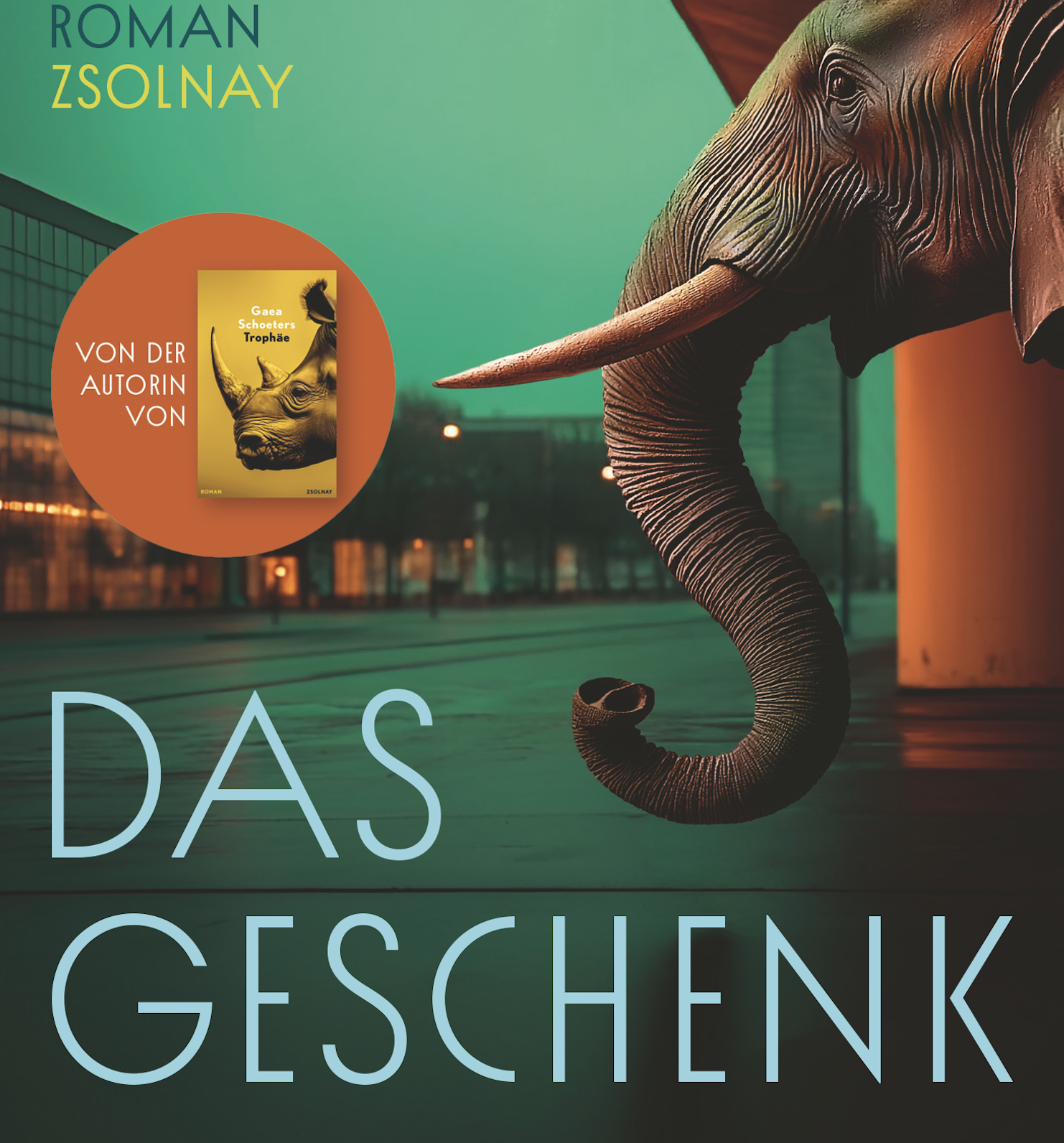
 God's Entertainment
God's Entertainment