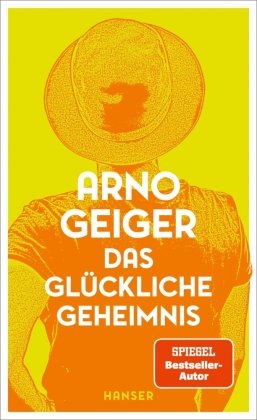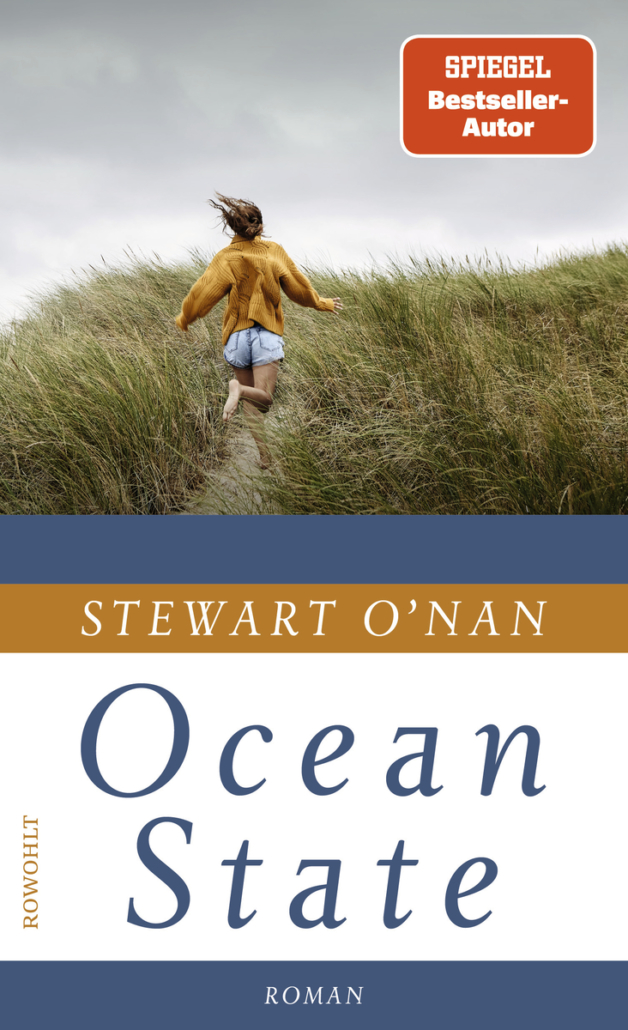John Irving wird 80
John Irving wird 80 – wir bringen ein Interview, das in Vorbereitung auf seinem Wien-Besuch 2005 bei „EineStadt.EinBuch.“ entstand.
Text: Helmut Schneider / Foto: Basso Cannarsa
John Irving, geboren 1942 in Exeter, New Hampshire, ist einer der erfolgreichsten Autoren weltweit. Viele seiner Romane wurden zu Weltbestseller, vier davon wurden verfilmt. 2000 erhielt er einen Oscar für die beste Drehbuchadaption für die Verfilmung seines Romans Gottes Werk und Teufels Beitrag.
Seit Jahren lebt Irving mit seiner kanadischen Frau in Toronto, wo ich ihn anlässlich der Wiener Gratisbuchaktion „EineStadt.EinBuch.“ auch besuchen durfte. 2005 wurde nämlich sein Erstlingsroman „Laßt die Bären los!“ in 100.000 Exemplaren in Wien verteilt. Irving lebte nämlich nach dem Weltkrieg eine Zeitlang in Wien und „Laßt die Bären los!“ ist eine Wiener Geschichte. Wie es zu diesem Buch kam, erzählte er mir im Interview – siehe unten. Wir gratulieren John Irving zu seinen 80. Geburtstag am 2.3.2022. 2023 soll wieder ein umfangreicher Roman von John Irving erscheinen.
Interview mit John Irving, geführt am 21. Dezember 2005 in Irvings Wohnung in Toronto
Das erste Buch eines Schriftstellers ist ja immer etwas Besonderes. Was sind Ihre Gefühle, wenn Sie an „Laßt die Bären los!“ zurückdenken?
IRVING: Es war ein Glücksfall für mich. Denn ich wählte zufällig eine Geschichte, die ich kannte, und somit hatte ich für meinen Roman sozusagen ein Fundament in der Faktenwelt. Eine der Geschichten, die ich in Wien erfuhr, war nämlich, dass während des Krieges die Tiere im Zoo sicher waren. Niemand bedrohte sie. Aber als die Wiener wussten, dass die Stadt fallen und von den Russen eingenommen werden würde, waren die Tiere des Zoos plötzlich verschwunden. Die Wiener waren sicher schon vorher hungrig und verzweifelt – aber sie beschützten den Zoo. Als sie hörten, dass die Sowjets kämen, wollten sie ihnen anscheinend die Tiere nicht überlassen. Es gibt allerdings keine schriftlichen Aufzeichnungen von dieser Geschichte, sondern das war etwas, was sich die Menschen in Wien erzählt haben. Ich habe mit Überlebenden darüber gesprochen; auch mit Menschen, die im Zoo arbeiteten, als die Stadt bombardiert wurde, und die die Tiere damals in Sicherheit gebracht haben.
Diese Zoo-Geschichte hat mich bewegt. Daneben zog ich Parallelen zu meiner Generation in den USA. Meine Generation wuchs auf, als Krieg in Vietnam war; aber sie wuchs auch auf mit den Erinnerungen an die Vätergeneration, die in einem anderen Krieg – dem Zweiten Weltkrieg – gewesen war. Die Vätergeneration konnte ja stolz sein auf ihren Einsatz im Weltkrieg. In meiner Generation war aber niemand mehr stolz darauf, im Vietnamkrieg zu kämpfen. Ich sah die österreichischen Studenten, die eine ähnliche, aber auch unterschiedliche Erfahrung wie ich hatten. Sie waren stolz auf einige Geschichten, die sie über ihren Krieg gehört hatten, aber ganz sicher nicht auf alle. Sie hatten das Gefühl, dass sich ein wichtiger Moment in der Geschichte bereits ereignet hatte, bevor sie auf die Welt gekommen waren. Aber für sie war das bereits Vergangenheit und sie fühlten sich nicht mehr dafür verantwortlich.
Was mich damals bewegte, war nun Folgendes: Ich fand zwar, dass es gute Beweggründe für einen Protest gegen den Vietnamkrieg gab, aber persönlich habe ich nie daran geglaubt, dass das irgendetwas bewirken könnte. Wir – die Amerikaner – sind letztendlich aus Vietnam abgezogen, weil wir verloren hatten und nicht weil wir auf irgendeine Meinung gehört hätten. Ich wollte dazu eine Geste finden, die ähnlich gut gemeint war, aber völlig dumm ist. Diese Jugendlichen in „Laßt die Bären los!“ haben ein gutes Herz, aber sie irren sich ja vollkommen – die Befreiung des Zoos endet in einem Desaster.
Ich hatte das Gefühl, die Frustrationen meiner Generation beschreiben zu müssen, obwohl ich persönlich mit Glück dem Vietnamkrieg entkommen bin. Ich war 1961 zu einer Offiziersausbildung vorgemerkt, weil ich damals Ringer war, und ich dachte, falls ich einen Einbruch hätte und nicht mehr ringen könnte, würde das Militär für mich die restliche Universitätsausbildung bezahlen. Das war für mich eine Absicherung. Ich wäre 1965 als Leutnant sicher nach Vietnam gekommen. Die Armee dachte damals, es wäre gut, wenn ich mein Deutsch verbessern würde und in ein deutschsprachiges Land käme. Aber als ich von Wien zurückgekommen war, habe ich gesehen, dass niemand mit meiner Ausbildung zum Dienst nach Berlin kommen würde. Ich bin da einer Katastrophe entkommen.
Darüber zu schreiben, war für mich nicht sinnvoll – weil das damals ja jeder tat. Jeder wurde auf die eine oder andere Weise vom Vietnamkrieg vereinnahmt. Ich dachte daher, dass ich einige Aspekte der Verunsicherung meiner Generation besser darstellen könnte, wenn meine Helden Österreicher und nicht Amerikaner wären. Und wenn sie gegen eine andere Historie rebellieren würden. Meine persönliche Biografie war hingegen wieder vom Zufall bestimmt. Ich heiratete, bevor ich Europa verließ, und mein erster Sohn wurde geboren, als ich noch an der Uni war. Das machte mich unantastbar für das Militär, denn sie nahmen keine Väter.
Sie hatten also einfach Glück.
Ja, das hatte ich. Denn dadurch sind mir die ganzen Überlegungen, was ich tun soll, erspart geblieben. Damals haben die jungen Menschen ja viele Dinge angestellt, um nicht nach Vietnam zu kommen – von Finger abschneiden bis sich ins Bein schießen. Aber ich hatte sozusagen eine Freikarte und schrieb stattdessen meinen ersten Roman „Laßt die Bären los!“
„Laßt die Bären los!“ ist also doch auch ein amerikanischer Roman.
Der Vietnamkrieg und die Generation, die mit diesem Krieg leben musste, waren der Hintergrund für das Buch. Denn man kann die Geschichte manchmal nicht richtig beurteilen, wenn sie gerade passiert. Aber es war leicht für mich, eine geschichtliche Periode zu beschreiben, die bereits vorbei war – konkret eben all die Verrücktheiten in Jugoslawien während des Zweiten Weltkrieges. Und es war leichter, diese Geister zum Leben zu erwecken und die zwei jungen, naiven österreichischen Studenten zu erschrecken. Und ich konnte es so aus dem amerikanischen Kontext nehmen, gleichzeitig aber das Thema behandeln.
Als das Buch zum ersten Mal erschien, bekam es gute Kritiken, wurde aber von den Lesern nicht viel beachtet. Aber ich verkaufte die Taschenbuchrechte und jemand wollte sogar einen Film daraus machen. Ich ging sogar zurück nach Wien, um am Drehbuch zu arbeiten. Es passierten interessante Dinge, aber nicht ein Kritiker von „Laßt die Bären los!“ sah Parallelen zum Vietnamkonflikt. Erst als das Buch in einige europäische Sprachen übersetzt wurde – speziell ins Französische und ins Deutsche –, erkannten die jeweiligen Kritiker, dass die Fatalität und Verzweiflung viel mit Vietnam zu tun hat. Die Franzosen und Deutschen sahen das als eine Art Parodie auf Vietnam. Allerdings wurde „Laßt die Bären los!“ eben erst zehn Jahre später, nämlich nach meinem Erfolg mit „Garp“, übersetzt.
Sie müssen für „Laßt die Bären los!“ viel österreichische und jugoslawische Geschichte studiert haben.
Mein Vater war Geschichtslehrer und so wusste ich von ihm, wie man sich Geschichte aneignet. Und ich wusste auch, dass die interessantesten Aspekte der Geschichte nicht die großen sind, sondern die eng umrissenen. Spannend ist sozusagen eine Art Tunnelblick auf die Geschichte. Man muss ganz tief in ein sehr begrenztes Feld gehen, um den Schlüssel für eine Zeit oder Epoche zu finden. Beispielsweise den Prozess studieren, in dessen Verlauf Mihailovic´ von einem Helden zu einem Schurken wurde und dann wieder zu einem Helden. Das ist ja noch immer nicht abgeschlossen im früheren Jugoslawien. Offensichtlich haben aber die Deutschen im Zweiten Weltkrieg mit ihrem Überfall auf Jugoslawien ahnungslos einen bereits bestehenden Krieg unterbrochen.
Weiters war für mich jene Zeit interessant, als Wien geteilt war. Einer meiner Lieblingsfilme als Jugendlicher war „Der dritte Mann“, mit den Szenen auf dem Schwarzmarkt und dem Leben im Untergrund. Das hat mich fasziniert.
Ich hatte jedenfalls schon mit dem Schreiben angefangen, als ich nach Wien gekommen bin, und der Lehrer, den ich hatte – auch ein Schriftsteller – riet mir, dass ich ins Ausland gehen solle. Denn all die Dinge, die einem in all den Jahren als normal vorkommen – so simple Sachen wie eine Milchflasche oder eine Zahnpastatube –, sieht man dann ganz anders. Wenn man ins Ausland geht, heißt das automatisch, dass einem die Augen geöffnet werden für einfachste Dinge – wie etwa dass der Kaffee in einem anderen Häferl serviert wird. Völlig unbedeutende, alberne Sachen. Aber die Erfahrung, wenn man in einem fremden Land lebt, ist die, dass man dort zunächst jedes Detail bewusst wahrnimmt. Und das gehört ja zum Handwerkszeug eines Schriftstellers, etwas, das ich durch meine erste Reise erfahren habe.
Ich habe hier in Wien zum ersten Mal begriffen, dass ich mein Leben lang immer wieder aus meiner Heimat herauskommen muss. Ich würde immer reisen müssen. Eine Zeit lang ging ich mindestens zwei bis drei Mal im Jahr nach Europa. Ich lebe sehr gerne einen Teil des Jahres in Kanada, nicht nur weil es das Heimatland meiner Frau ist, sondern weil es immer wichtiger wird, sein eigenes Land von außen zu sehen. Wenn man immer nur als Inländer sein Land betrachtet, sieht man gar nichts. Ich behaupte: Wenn mehr Amerikaner ihr Land mit den Augen anderer sehen würden, könnte Bush niemals ihr Präsident sein.
Ich lernte in Wien viel über eine bestimmte Phase der österreichischen und jugoslawischen Geschichte. Das sieht man ja auch im Roman. Aber im Rückblick war die Zeit in Wien nicht deshalb so wichtig für mich, weil ich so viel über Wien erfahren habe, sondern weil es meine erste Erfahrung damit war, meine Heimat aus der Distanz zu sehen. Ich verbringe heute noch viel mehr Zeit mit meinen europäischen Verlegern als mit meinen Verlegern in New York. Dort ist das, offen gesagt, einfach eine Geschäftssache, es gibt da keine persönliche Beziehung. Ich mache in den USA auch viel weniger in den Medien als in Europa. Und ich habe auch mehr mit meinen kanadischen Verlegern als mit meinen amerikanischen zu tun. Und natürlich ist es auch viel interessanter für mich und meine Familie, nach Berlin, Hamburg oder Wien zu fahren als nach Kansas City.
Und nicht zuletzt lernte ich in Wien viel über Musik. Ich habe damals schon gerne Opern gehört – obwohl ich nie eine im Theater gesehen habe. Aber viele meiner Romane haben auch etwas Opernhaftes. Man könnte sagen, dass meine Geschichten viel mehr Gemeinsamkeiten mit Opern haben als mit Romanen anderer Autoren.
Auch meine ersten Erfahrungen im Drehbuchschreiben habe ich in Wien gemacht. Ich hatte keine Ahnung, wie man ein Drehbuch schreibt, als mich Direktor Irvin Kershner einlud, mit ihm das Drehbuch zu „Laßt die Bären los!“ zu schreiben. Ich hatte absolut keine Idee, wie man diesen Roman verfilmen könnte. Aber gefreut hat mich vor allem, dass ich dafür nach Wien geschickt wurde.
Sie waren ja im Schloss Eichbüchl untergebracht – einem für die österreichische Geschichte wichtigen Ort –, also gar nicht in Wien.
Ja, aber ich kam fast jeden Tag nach Wien und war viel im Theater. Aber auch das Schloss habe ich sehr geliebt. Da wohnte mein ehemaliger Professor, den ich von meiner Studienzeit her kannte.
„Laßt die Bären los!“ ist gekennzeichnet durch die für Sie sehr spezielle Mischung aus Komödie und Tragödie. Wir lernen da zwei junge Menschen kennen und lieben und dann stirbt einer ganz unvermutet. So etwas erwartet man nicht – es sei denn, man ist ein gelernter Irving-Leser.
Ja, das wurde sehr charakteristisch für mich. Die Figuren in meinen Romanen tun oft etwas, weil Menschen verloren gehen. Hannes Graff hat nicht einmal die Hälfte von Siggis Vorstellungsvermögen und er hat auch nicht annähernd so viel historischen Hintergrund. Graff ist ein Gefolgsmann. Es war meine erste Erfahrung als Autor mit dem Thema Verlust eines geliebten Menschen. Ich habe das später noch ausführlicher dargestellt.
In der Figur von Graff spiegelt sich aber auch so etwas wie die naive erste Annäherung eines Amerikaners an die europäische Kultur wider. Da sind auch meine Erfahrungen als Amerikaner in Wien drinnen. Ich stieß hier in Wien auf eine Kultur, die bis zum Römischen Reich zu-rückreicht, während unsere eigene ja gerade einmal ein paar hundert Jahre ausmacht. Dabei kam ich ja vom einzigen Teil Amerikas, wo es wirklich so etwas wie eine Historie gibt. Wir waren ja zumindest eine englische Kolonie. Dabei stellt sich Neuengland höchst unterschiedlich zum Rest von Amerika dar. Es war etwa definitiv keine gute Wahl, John Kerry gegen Bush ins Rennen zu schicken. Weil Kerry den ältesten, am besten gebildeten und geschichtsbewusstesten Teil der USA repräsentiert. Die meisten Amerikaner fühlen sich da nicht angesprochen.
Komödie und Tragödie waren in meinem Denken immer beisammen. Das hängt auch mit meinen Leseerfahrungen als Heranwachsender zusammen. Meine erste Liebe als Leser war Charles Dickens. Dickens ist auch in einer Minute tragisch und in der nächsten voll Komik. Und in meiner Zeit in Wien habe ich die „Blechtrommel“ von Günter Grass gelesen. Keine Frage, dass Grass auf mein erstes Buch Einfluss hatte. Und auch bei Grass gibt es diese Kombination von Tragödie und Komödie – da stirbt auch jemand von einer Minute auf die andere. Grass ist eben auch sehr „dickenshaft“. Auch in dem Punkt, dass er eine soziale Intention hat. Grass ist ein Moralist – genauso wie ich.
Wie entwickeln Sie Ihre manchmal ja sehr ungewöhnlichen Ideen?
Was ich brauche, ist Folgendes: Ich muss jene Obsessionen meiner Charaktere kennen, die sie nicht kontrollieren können. Denn es muss etwas geben, das sie außerhalb der Norm agieren lässt, sie sogar zu Helden machen kann. Wenn ich eine Romanfigur gefunden habe, die von etwas besessen ist, weiß ich, dass ich damit arbeiten kann.
Nach meiner Erfahrung haben Sie in Wien besonders viele weibliche Fans. Überrascht Sie das?
Das ist sicher richtig, aber keine österreichische Besonderheit. Ich denke, dass einfach viel mehr Frauen Romane lesen als Männer. Wenn Männer überhaupt lesen, lesen sie eher Sachbücher. Das ist in den USA so wie auch überall sonst. Jedes Mal wenn ich in ein Flugzeug steige, sehe ich, dass wenn Männer überhaupt Romane lesen dann jene von John Grisham oder Tom Clancy. Aber meistens lesen Rechtsanwälte Bücher über Gesetze usw. Wenn mich jemand anspricht – im Flugzeug oder wie gestern beim Weihnachtseinkauf –, dann ist das in neun von zehn Fällen eine Frau. Oder – was auch vorkommt – ein Mann erzählt mir, dass ich der Lieblingsschriftsteller seiner Frau, seiner Tochter oder seiner Mutter bin.
Lesen Sie selbst aktuelle amerikanische Literatur?
Ich war ein sehr eifriger Leser als Kind und Heranwachsender. Jetzt lese ich nur dann viel, wenn ich gerade zwischen zwei meiner Romane bin. Wenn ich also gerade einen neuen Roman abgeschlossen habe und mir nur Notizen für den nächsten mache. Da schreibe ich dann zwei Stunden am Tag anstatt zehn. In dieser Phase kann ich dann auch viel lesen. Im Prozess des Schreibens arbeite ich sehr lange Zeit jeden Tag am neuen Roman und lese gar nichts. So gibt es eben nur alle drei, vier, fünf Jahre diese Periode – die ungefähr ein halbes bis ein ganzes Jahr dauert –, in der ich lesen kann. Leider habe ich aber auch mit dem Drehbuchschreiben begonnen, sodass meine Schreib-pausen immer kürzer werden. So bin ich nicht mehr der eifrige Leser, der ich einmal war. Aber es gibt natürlich Autoren, die ich lese und schätze. Nicht allzu viele amerikanische – Hemingway verabscheue ich geradezu und ich war auch nie an Faulkner oder Fitzgerald interessiert wie viele meiner intellektuellen Freunde. Am bedeutendsten sind für mich, wie gesagt, Dickens und auch Thomas Hardy.
Von den lebenden Autoren schätze ich Günter Grass, Gabriel García Márquez und Salman Rushdie. Und kanadische Autoren finde ich besonders interessant. Ich habe mehr Freude an kanadischer Literatur, weil Toronto die Stadt ist, in der ich einen Teil des Jahres lebe. Dann habe ich natürlich auch Freunde, deren Bücher ich immer lese, wie den bereits erwähnten Salman Rushdie oder Julian Barnes, mit dem ich eng befreundet bin. Ebenso verbunden bin ich mit Michael Ondaatje und Peggy Atwood. Seit dem Tod von Robertson Davies schlage ich jetzt immer Alice Munro vor, wenn mich das Nobelpreiskomitee fragt. Bei Davies bin ich ja nicht erfolgreich gewesen. Ich hoffe, dass Alice den Preis bekommt, bevor sie stirbt.
Für Freizeitbeschäftigungen haben Sie demnach – außer fürs Ringen – nicht mehr viel Zeit.
Ringen mache ich seit meiner Verletzung nicht mehr – das habe ich meiner Frau versprochen. Zumal die Verletzung einen Finger betroffen hat, mit dem ich schreibe. Das konnte ich dann sechs Monate lang nicht. Aber ein bisschen Boxen und Kickboxen mache ich wieder. Und ich bin jeden Tag im Fitnessraum. Daneben laufe ich, fahre ich Rad, aber auch Ski und spiele ich Tennis.
(Das Interview führte Helmut Schneider – Alice Munro hat 2013 dann tatsächlich den Nobelpreis für Literatur bekommen.)