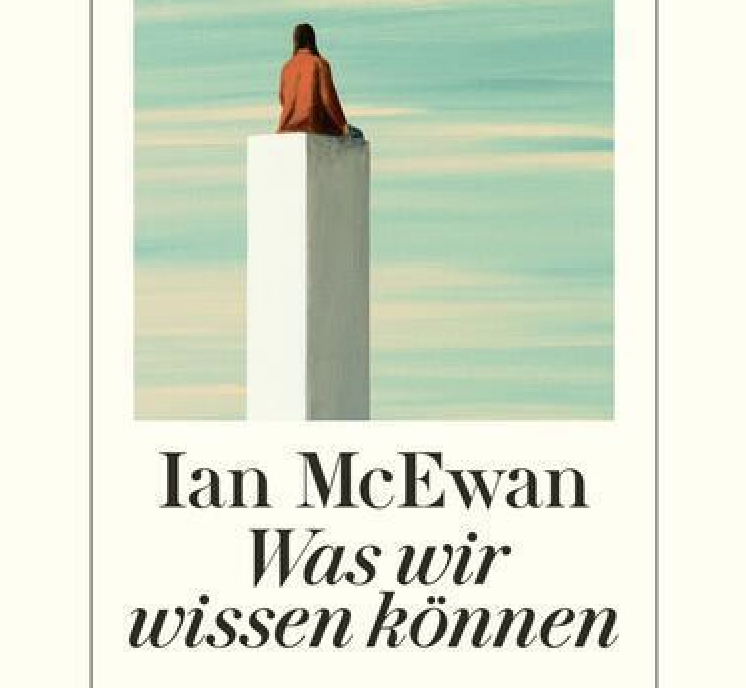Ausgerechnet ein Literaturwissenschaftler erzählt im neuen Roman des englischen Bestsellerautors Ian McEwan („Amsterdam“, „Der Trost von Fremden“) „Was wir wissen können“ – und das auch eher beiläufig – 2119 aus dem Blick von 100 Jahren später von den Katastrophen des 21. Jahrhunderts. Diverse Kriege und Überschwemmungen machten die Welt nicht eben besser, aber immerhin gibt es Heilung für Krankheiten wie Alzheimer und Drogen für den Seelenfrieden. Der Schreibprofi wusste wohl, dass diese Dystopien längst auserzählt sind und schrieb daher ein Buch über ein absolutes Orchideenthema: Der Dichter Francis Blundy soll Anfang des 21. Jahrhunderts beim Geburtstagsessen für seine Frau Vivian einen Sonettenkranz vorgelesen haben, der danach als perfekte Dichtung ebenso mythisch wie unauffindbar geworden ist. Im ersten Teil des Romans forscht Thomas Metcalfe mehr und mehr besessen nach diesem Gedicht, wobei er sich immer mehr mit Bundys Ehefrau Vivien fast krankhaft identifiziert. Am Ende findet er tatsächlich eine Zeitkapsel mit einem Text von Vivian, die damit endgültig zu McEwans Hauptperson wird. Dieser Text – eine Art Tagebuch – bildet den zweiten und eigentlich interessanteren Teil. Im Zentrum steht Vivians Beziehung zu ihren Männern und Liebhabern – die Literaturwissenschaftlerin war nämlich in erster Ehe mit dem liebevollen Geigenbauer Percy verheiratet, der leider früh an Alzheimer erkrankte. Vivian findet in Blundy und seinem Schwager Harry nicht nur sexuelle Zerstreuung, sondern kann mit den beiden auch ihren intellektuellen Hunger stillen, denn Percy interessiert sich nicht für Literatur. Aus dem Liebesverhältnis von Vivien mit Blundy wird schließlich nach einem naheliegenden Verbrechen ein düsteres Bündnis.
„Was wir wissen können“ ist bestimmt nicht der beste Roman des Autors, man wir schnell müde, die x-te Dystopie zu lesen – das Genre scheint in letzter Zeit viel zu strapaziert worden zu sein. Am gelungensten ist die Schilderung des akademischen Freundeskreises um Blundy, den wir als etwas gockelhaften Intellektuellen mit einem kaum gezähmten Hang zur Überheblichkeit erleben. Witzig ist der Blick auf die Gegenwart aus der Perspektive der Zukunft allemal. Die Eheprobleme des Erzählers im ersten Teil scheinen freilich zu klischeehaft. Und Vivien? Nun, im ersten Teil erscheint sie als selbstlose Frau, die ihre wissenschaftliche Karriere für ein Genie opfert. Im zweiten Teil – in dem sie selbst spricht – wird ihr Bild differenzierter. McEwan zeichnet einen Menschen, der in seinen Leidenschaften und Vorstellungen gefangen ist – so wie wir alle eben. Und das ist dann wieder beste Literatur.
Ian McEwan: Was wir wissen können. Aus dem Englischen von Bernhard Robben, Diogenes, 470 Seiten, € 28,80