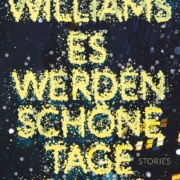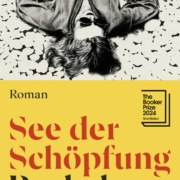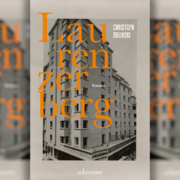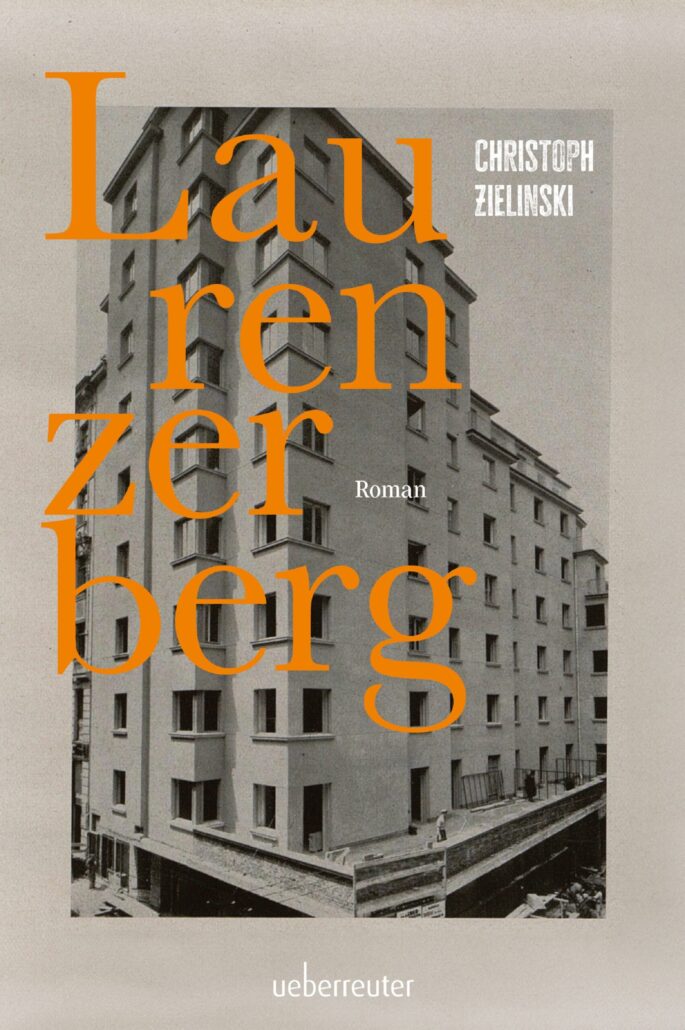Zwischen Mensch und Maschine: Lisz Hirn beim Café Creativ
Am 13. Mai fand die fünfte Ausgabe von Café Creativ im traditionsreichen Café Landtmann statt. Zu Gast war diesmal die renommierte Philosophin Lisz Hirn, die ihr aktuelles Buch „Der überschätzte Mensch – Was machen KI, Smartphone und ChatGPT mit uns als Mensch“ (Zsolnay Verlag) präsentierte.
Vor ausverkauftem Haus sprach Hirn pointiert über die Herausforderungen der digitalen Gegenwart und stellte die zentrale Frage: Wie viel Mensch bleibt im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz noch übrig?
KI: Keine Intelligenz, sondern nützliches Werkzeug
Lisz Hirn brachte es auf den Punkt: Künstliche Intelligenz sei derzeit keine echte Intelligenz, sondern basiere auf maschinellem Lernen. Richtig eingesetzt, könne sie den Alltag erleichtern und für mehr Bequemlichkeit sorgen – im Privatleben ebenso wie im Arbeitsalltag. Doch Hirn warnte auch: „KI sagt nicht immer die Wahrheit.“ Kritisch müsse man hinterfragen, wer die Systeme mit Daten speist und mit welchen Interessen dies geschieht.
Empathie bleibt menschlich
Eines machte Hirn unmissverständlich klar: Entscheidungen, die Empathie erfordern, dürfen niemals Maschinen überlassen werden. Trotz aller technologischen Fortschritte bleibe der Mensch gefordert, Verantwortung zu übernehmen und ethische Maßstäbe zu setzen.
Moderation mit Wiener Schmäh
Durch den Abend führte Dr. Ursula Scheidl, Chefredakteurin im echo Medienhaus, die mit gewohntem Charme und Fachwissen die Brücke zwischen philosophischer Reflexion und gesellschaftlicher Relevanz schlug.
Café Creativ als Plattform für lebendige Diskurse
Die fünfte Ausgabe von Café Creativ hat eindrucksvoll bewiesen, wie inspirierend, kritisch und unterhaltsam ein Diskurs über brennende Themen unserer Zeit sein kann. Für alle, die Inspiration und Tiefgang suchen, ist diese Veranstaltungsreihe längst zum Pflichttermin geworden.
Foto: Stefan Diesner

 Stefan Diesner
Stefan Diesner