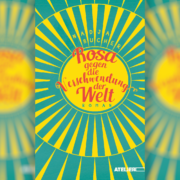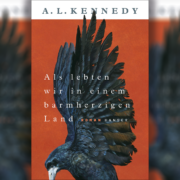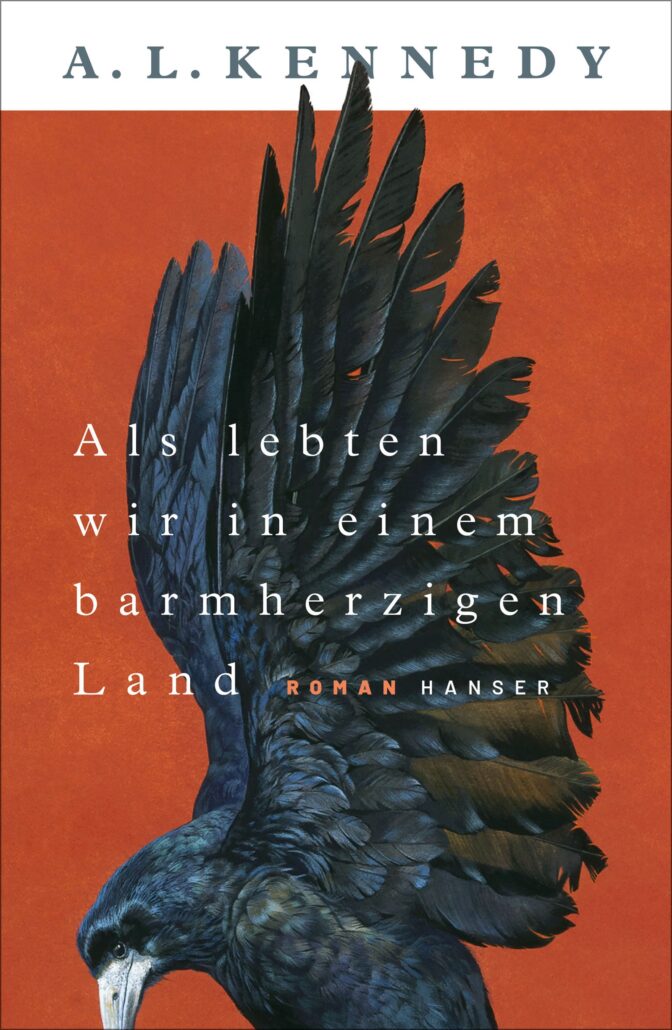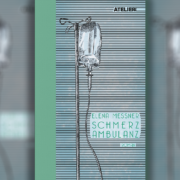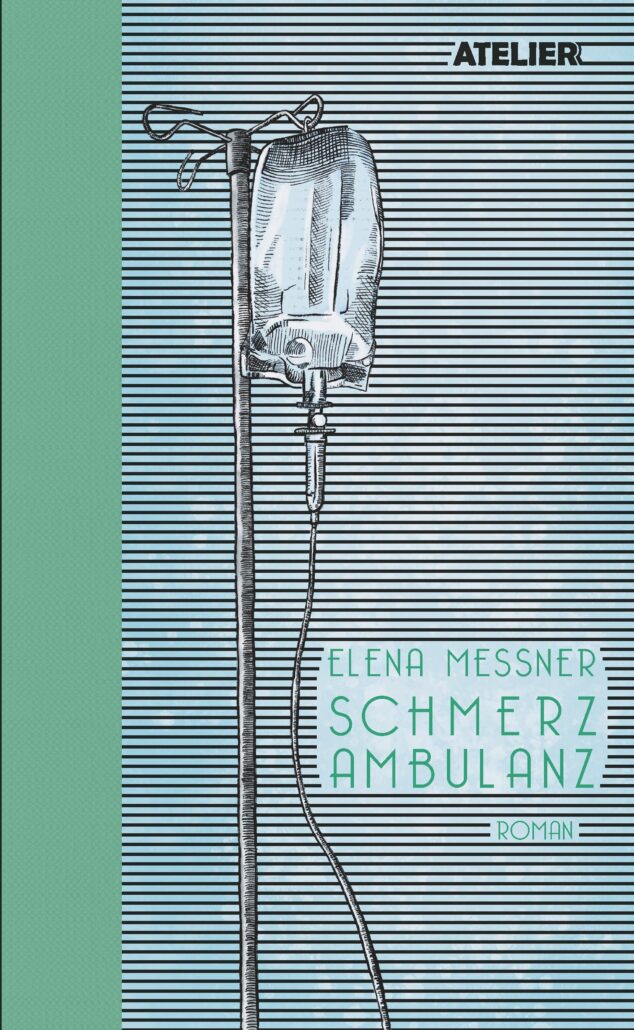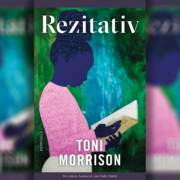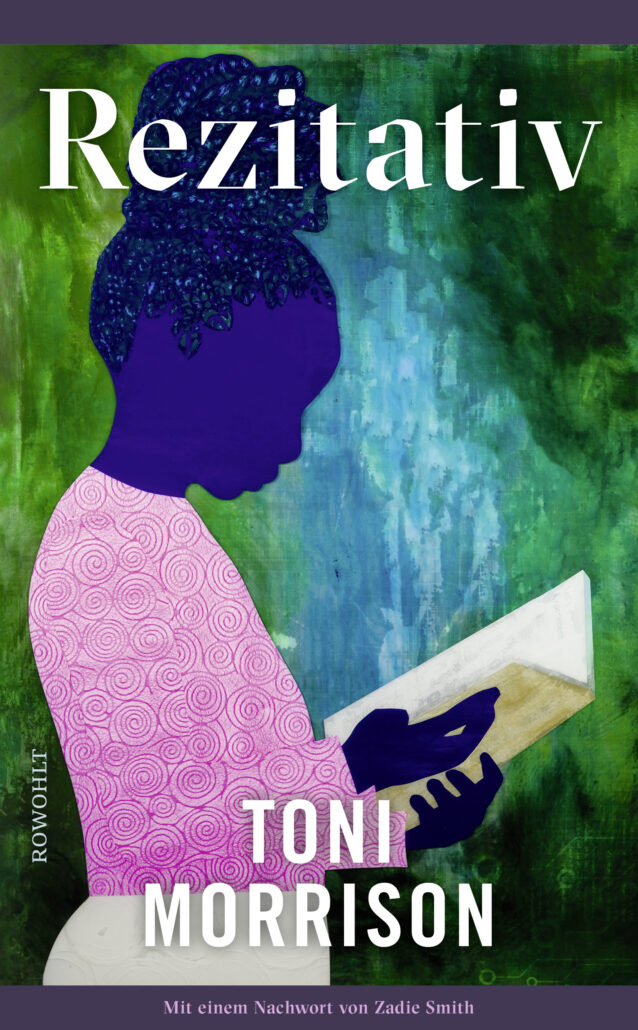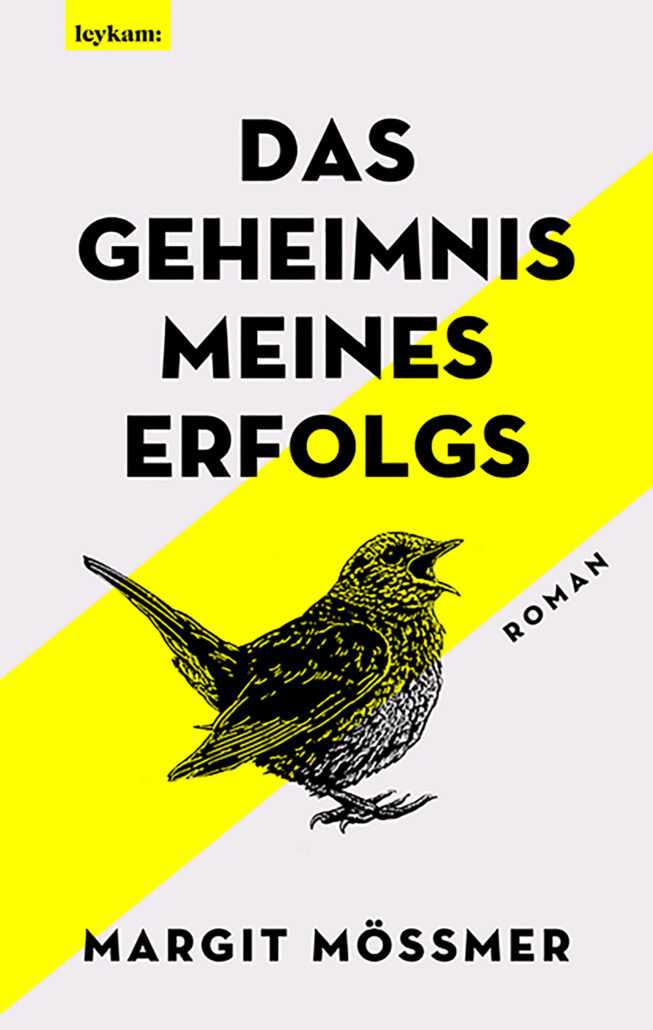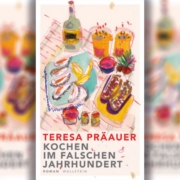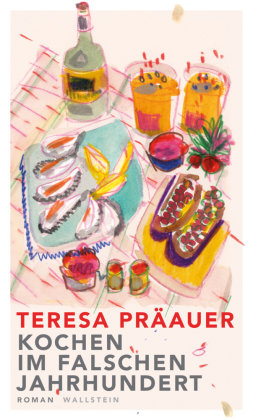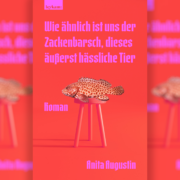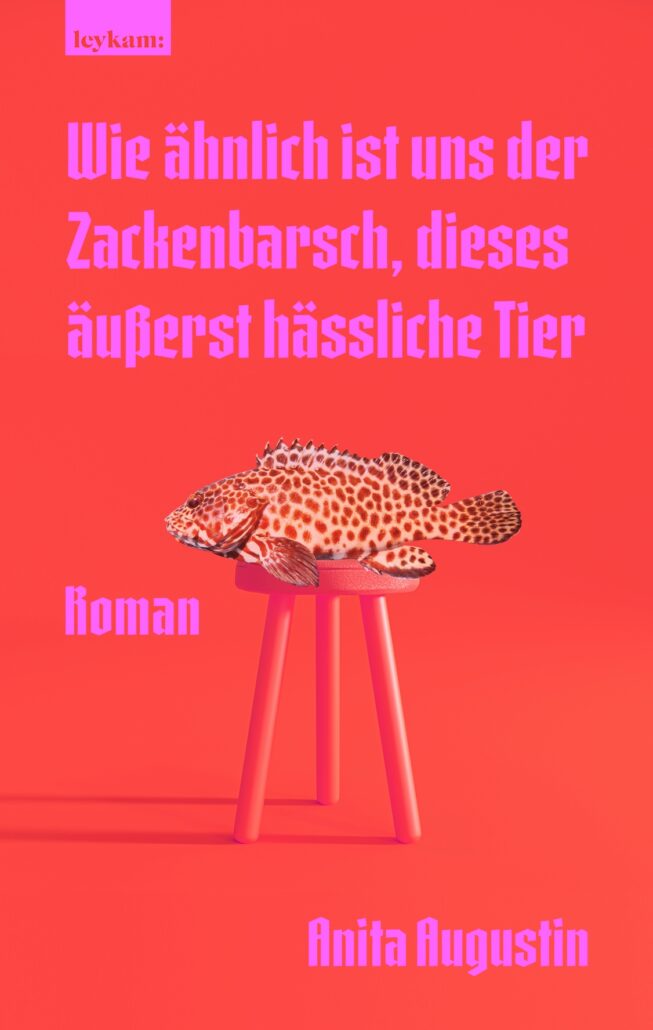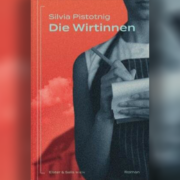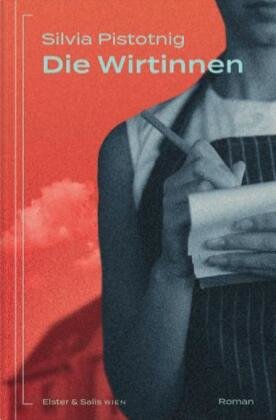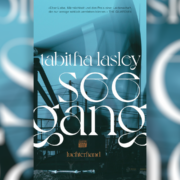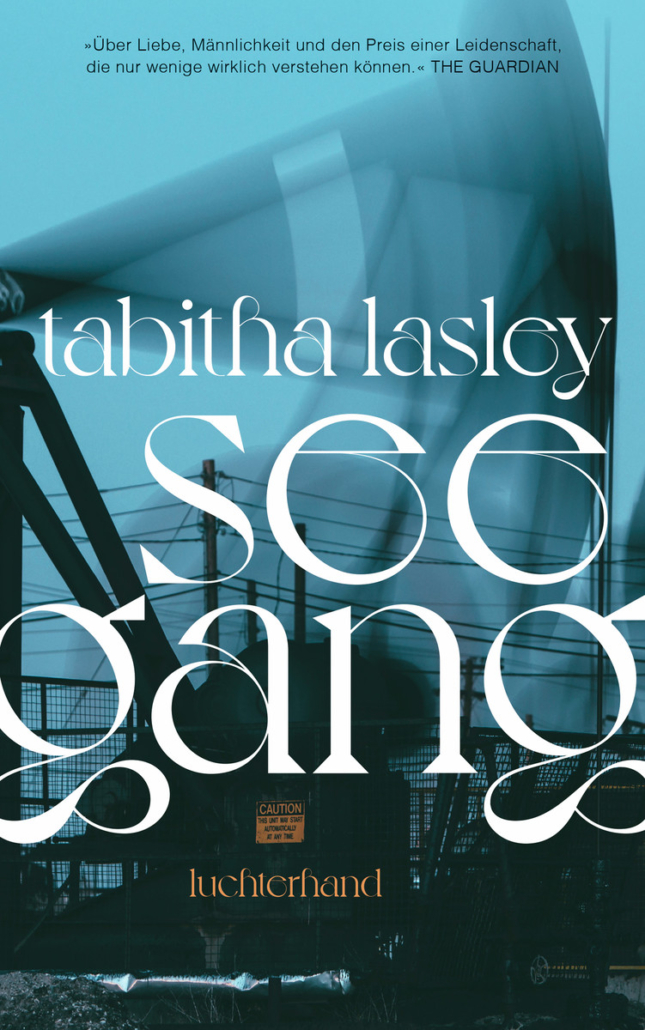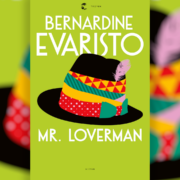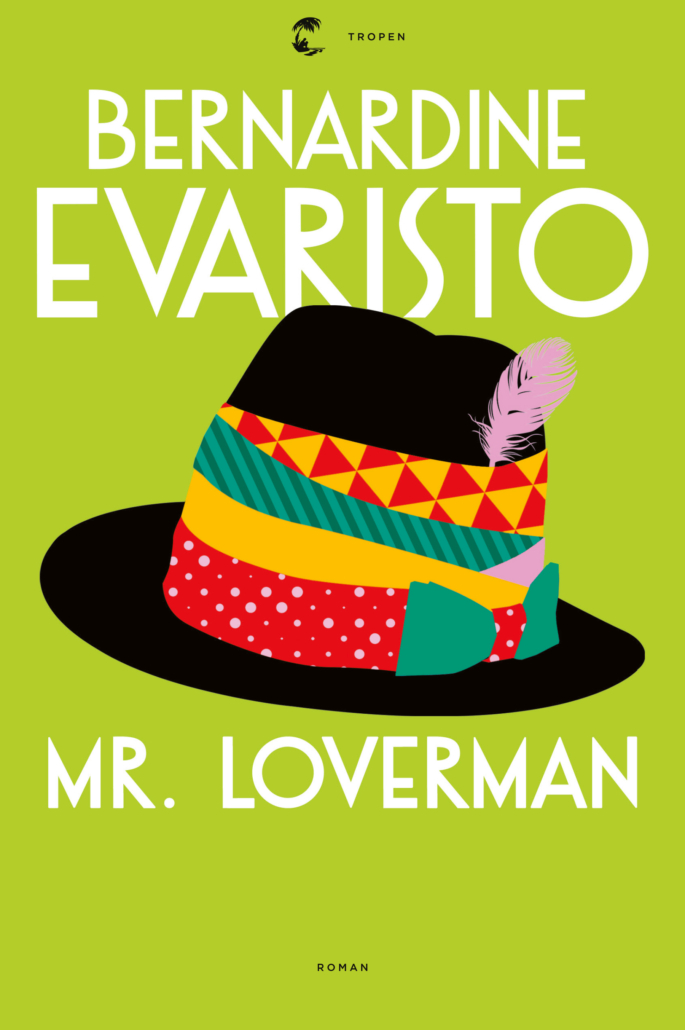Die Klimaschützerin beim AMS – Nadja Buchers Roman „Rosa gegen die Verschwendung der Welt“
Die Wiener Schriftstellerin Nadja Bucher debütierte 2013 mit dem Roman „Rosa gegen den Dreck der Welt“, in dem die ökologisch gestimmte Putzfrau Rosa mit Verve gegen Stromfresser, SUV-Fahrer und andere Umweltsünder ankämpft. Jetzt erscheint eine Fortsetzung. In „Rosa gegen die Verschwendung der Welt“ hängt die Protagonistin frustriert ihren Job an den Nagel, weil sie nicht länger bei hoffnungslosen Energieverschwendern putzen will. Das Angebot ihres Freundes Bertram, in seinem stets wachsenden Bioladen zu arbeiten, schlägt sie aus. Denn der ist ihr doch zu sehr Bobo-Unternehmer und Verbündeter seiner gutverdienenden Kunden geworden. Während andere von ihrem ökologischen Fußabdruck reden, will Rosa am liebsten gar nicht auftreten, sondern schweben. Ihre Wohnung ist spartanisch eingerichtet, ihr Energieverbrauch tangiert gegen Null, Strom hat sie sowieso abgemeldet. Dabei versorgt sie selbstlos ihre alte Nachbarin. Wie sich nach deren Tod herausstellt, ist die Nachbarin die Besitzerin des Mietshauses und Rosa braucht keine Miete mehr zu bezahlen.
Doch da Rosa arbeitslos gemeldet ist, bleibt ihr ein AMS–Fortbildungskurs nicht erspart. Bucher schildert genüsslich und detailreich die verschiedenen Kursteilnehmerinnen und -nehmer. Eine von ihnen macht dann Rosa – zunächst ohne ihr Einverständnis – zur Jeanne d’Arc der Umweltbewegung. Wie das Social-Media-Experiment entgleist, bestreitet dann einen Gutteil des wirklich sehr amüsant zu lesenden Romans, in dem man auch sehr viel über die gerade stattfindenden, das Klima ungünstig beeinflussenden Transformationen erfährt.
Nadja Bucher ist mit ihrem Roman eine Art moderner Bartleby gelungen, ihre Rosa will eben lieber nicht von den „Segnungen“ der modernen Welt profitieren. Am 19, Mai wird sie um 16.30 Uhr beim Literaturfestival „Rund um die Burg“ ihr Buch Roman „Rosa gegen die Verschwendung der Welt“ präsentieren.
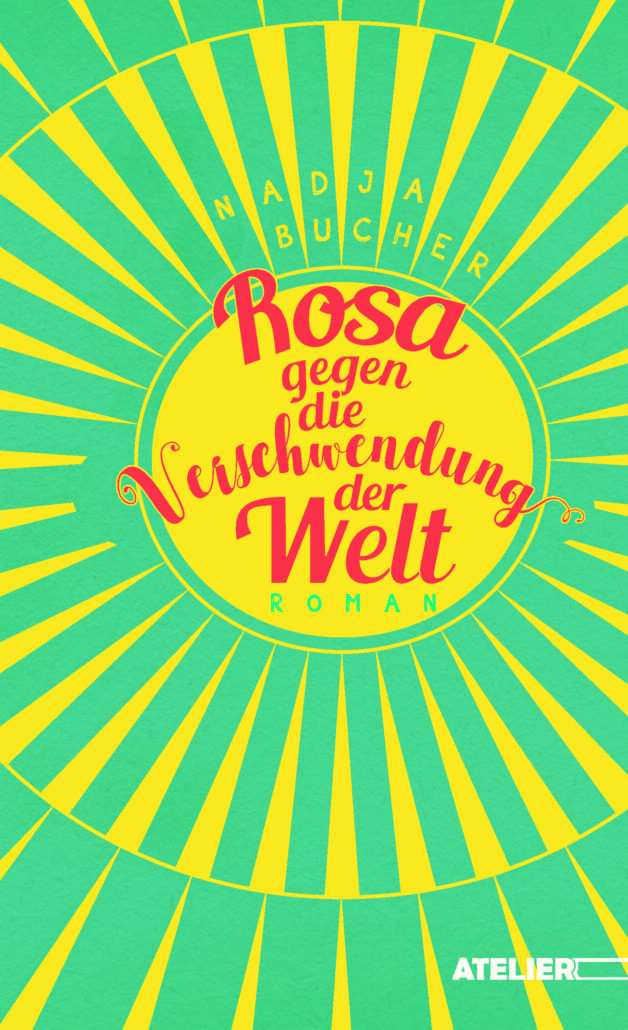
Nadja Bucher: Rosa gegen die Verschwendung der Welt
Edition Atelier
272 Seiten
€ 20,-