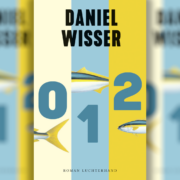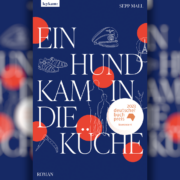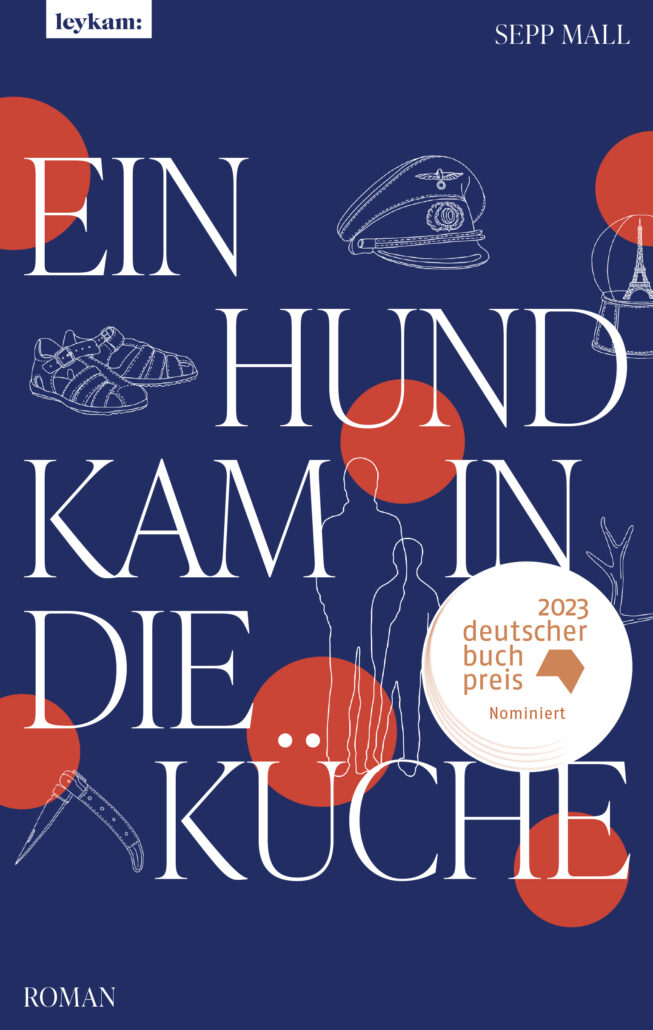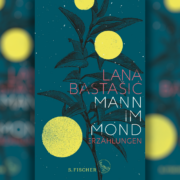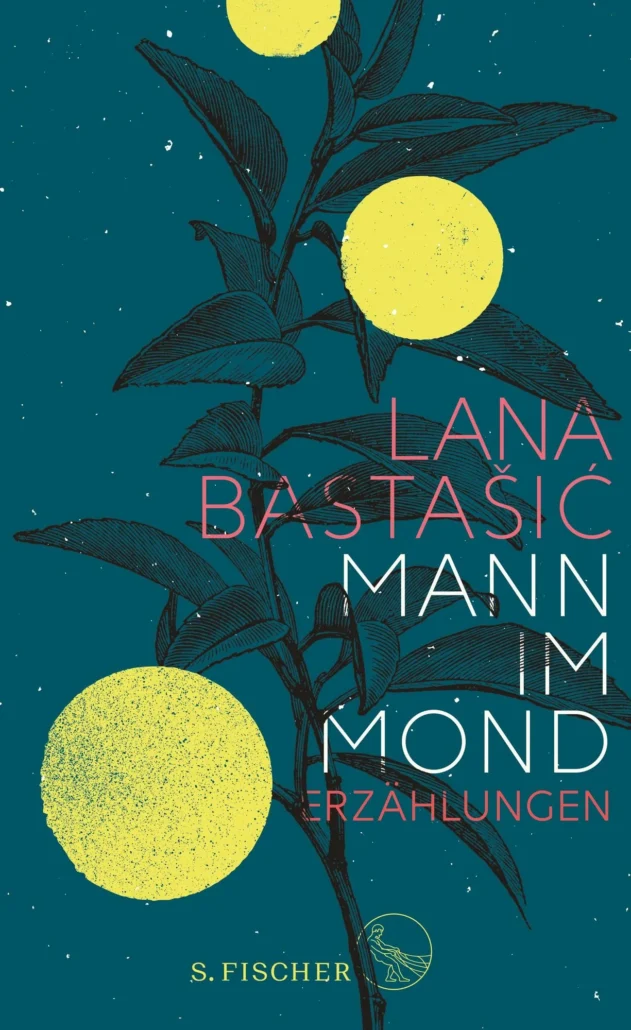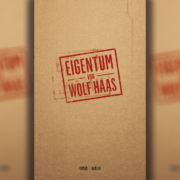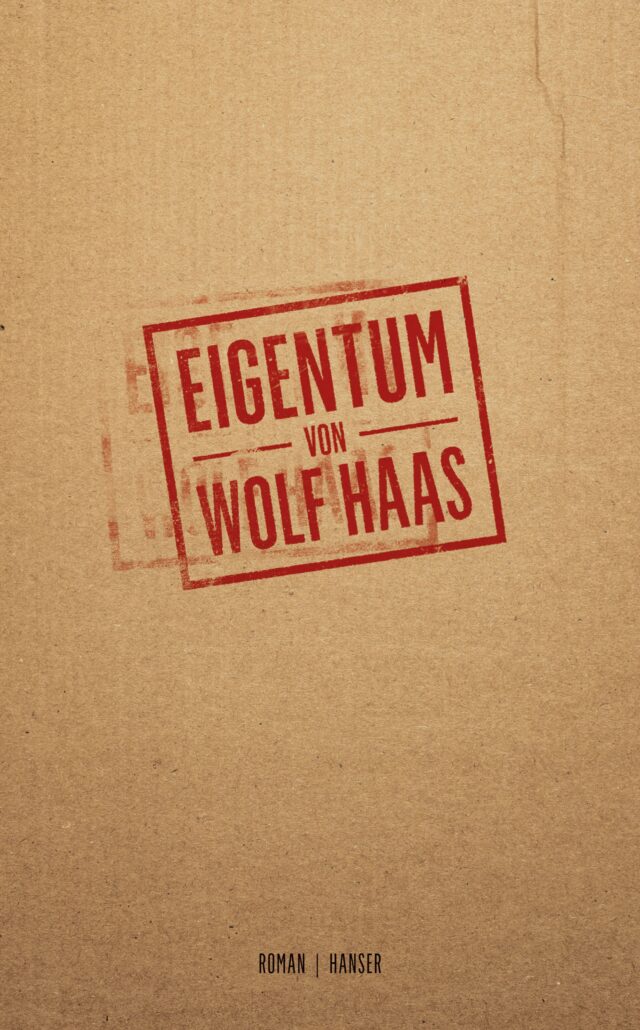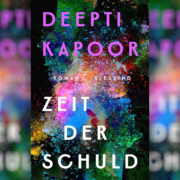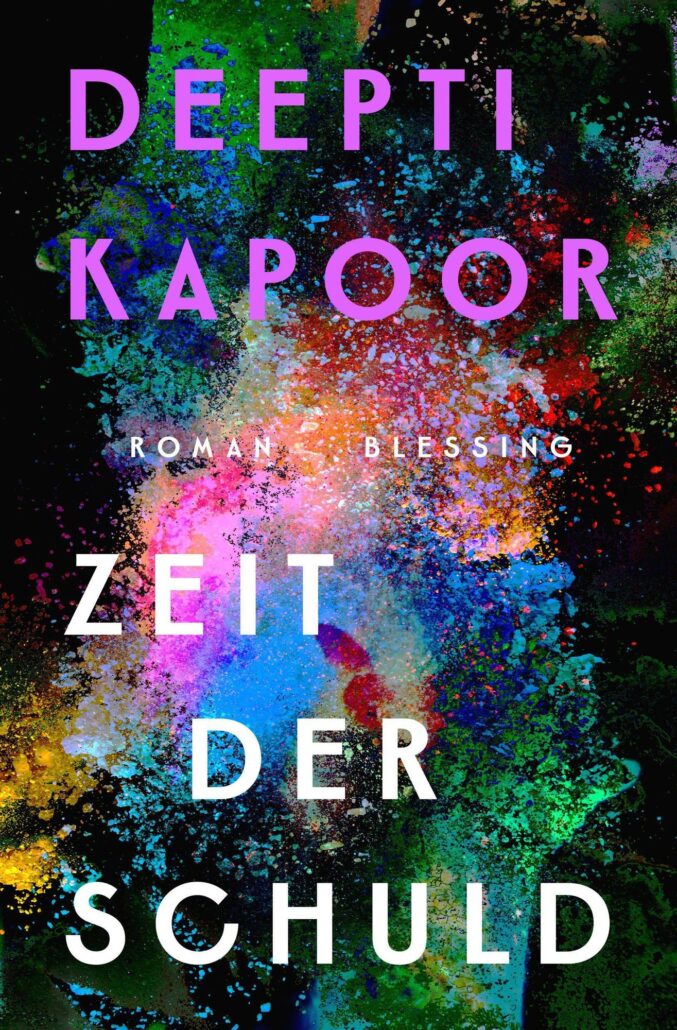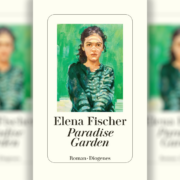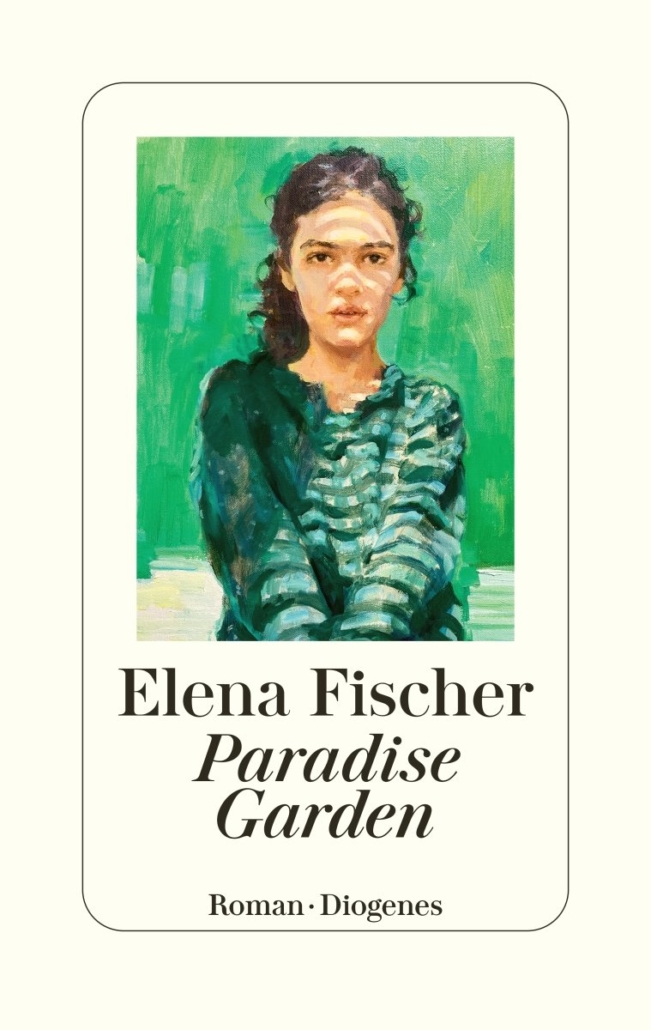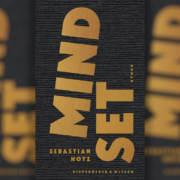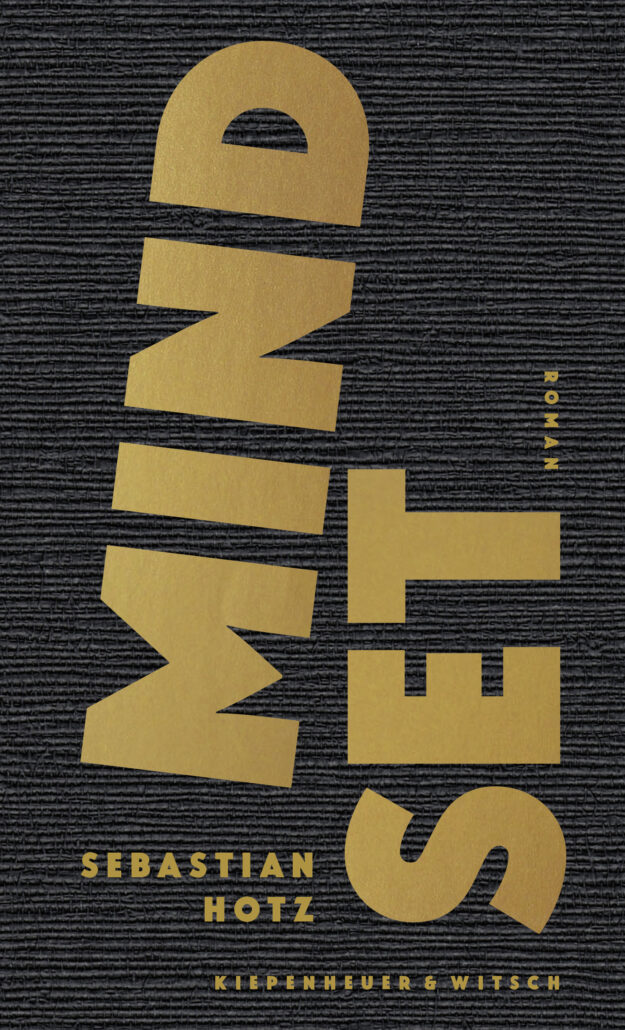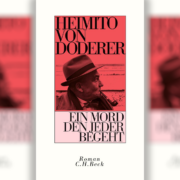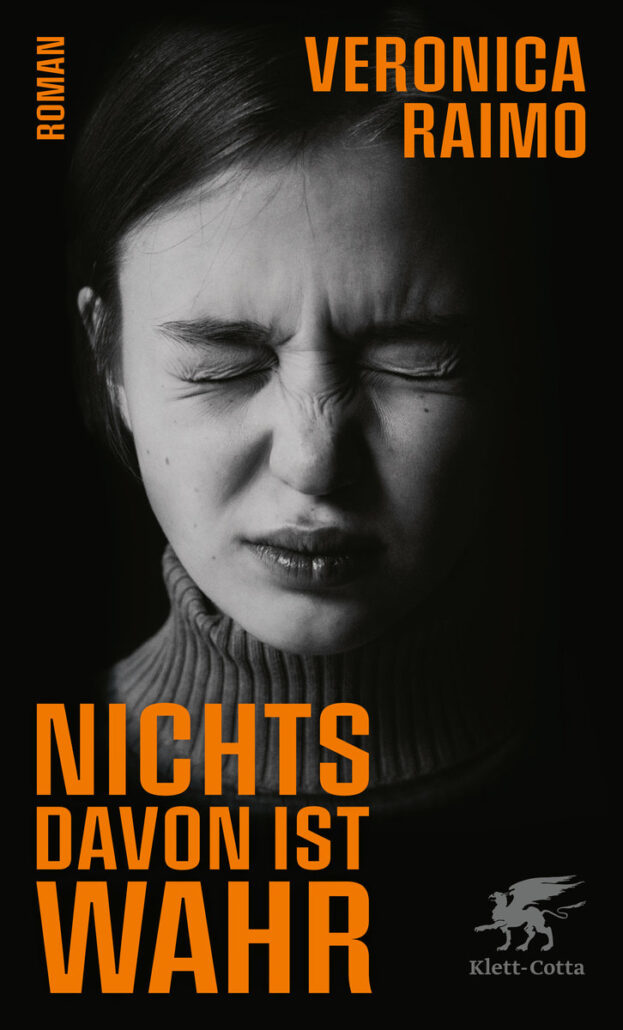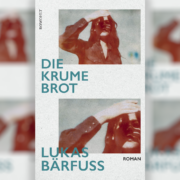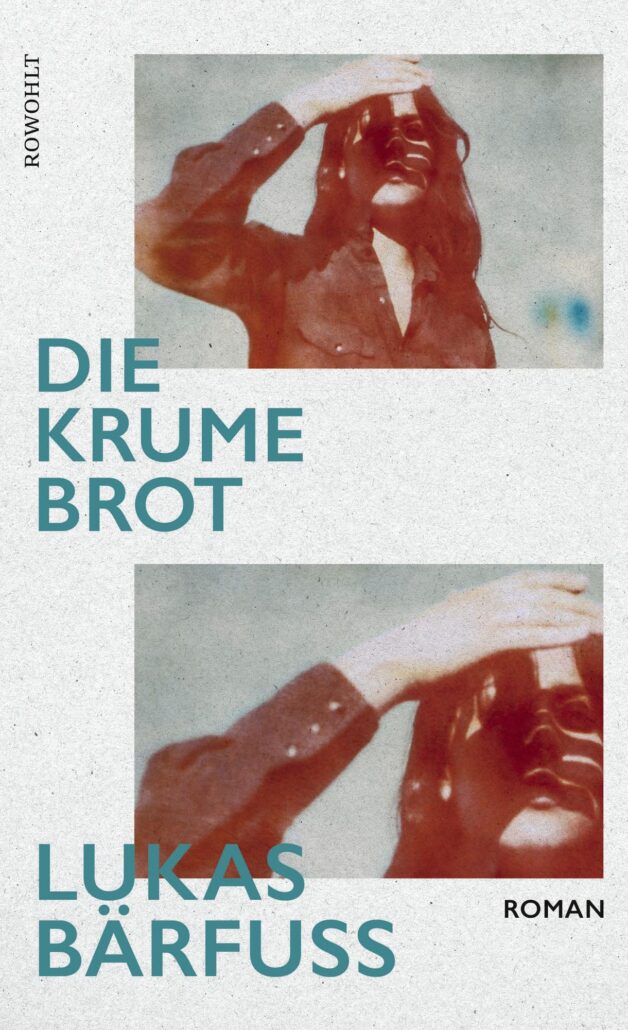Das zweite Leben des Erik Montelius – Daniel Wissers Schelmenroman „012“
Wenn jemand 30 Jahre nach seinem frühen Tod wiederkommt, um sein früheres Leben wieder aufzunehmen, ergibt das natürlich Komplikationen. Welche, das hat der in Wien lebende Autor Daniel Wisser in seinem neuen Roman erforscht. Sein Protagonist und Erzähler Erik Montelius lässt sich – weil sein Krebs nicht heilbar ist – nach durchaus erfolgreicher Karriere als Computerpionier einfrieren. In der Gegenwart wird er operiert und wacht auf – als erster Mensch, der die kryotechnische Konservierung sozusagen überlebt. Im ersten Teil denkt er, im Krankenhaus liegend, viel über sein voriges Leben nach. Trost und Rat holt er sich von Beatles-Songs, denn „Abbey Road“ war im ersten Leben quasi seine Bibel. Turbulent wird es erst, als er zu seiner früheren Frau Kris heimkehrt, denn diese hat inzwischen seinen Kompagnon und Freund geheiratet. Sein Sohn ist natürlich längst erwachsen. Montelius erlebt die Seltsamkeiten unserer Zeit mit der Brille der 90er-Jahre: Autos sind groß wie Panzer und fahren noch immer mit Benzin, Plastik ist sowieso überall und unvermeidlich. Erst zögerlich bedient er sich Neuerungen wie Smartphones. Nicht ganz unbegründet nimmt er an, dass sein ehemaliger Partner ihn beim Verkauf ihrer Firma betrogen hat. Als er einer Journalistin vom Lokalfernsehen ein Interview gibt, läuft die internationale Medienmaschinerie an – sogar CNN fragt an. Auch ein Verlag hat Interesse an seiner Biografie – was wir lesen ist sozusagen das launige Manuskript, das Montelius abgeben will.
Zum eigentlichen Problem wird allerdings, dass er offiziell gar nicht existiert, denn er hat ja nur seinen Totenschein. Und ausgerechnet mit der eigenwilligen Tochter seines Kompagnons beginnt er eine neue Beziehung – wissend, dass er mutmaßlich wegen seiner wiederkehrenden Krebserkrankung und dem schlechten Zustand seiner Organe nicht mehr lange leben wird. Montelius landet schließlich zuerst im Gefängnis und dann in einen Asylantenheim – als Existenz, die es gar nicht geben kann. Dazwischen brennen SUVs und Menschen sterben unter ungeklärten Ursachen.
Daniel Wisser ist ein sehr flüssig zu lesender Roman über unsere Zeit gelungen. Mit scharfer Beobachtungsgabe zeigt er die Verwerfungen unseres Daseins auf. Der phantastische Plot ist nur die Folie, um Spießertum und Gedankenlosigkeit sichtbarer zu machen.
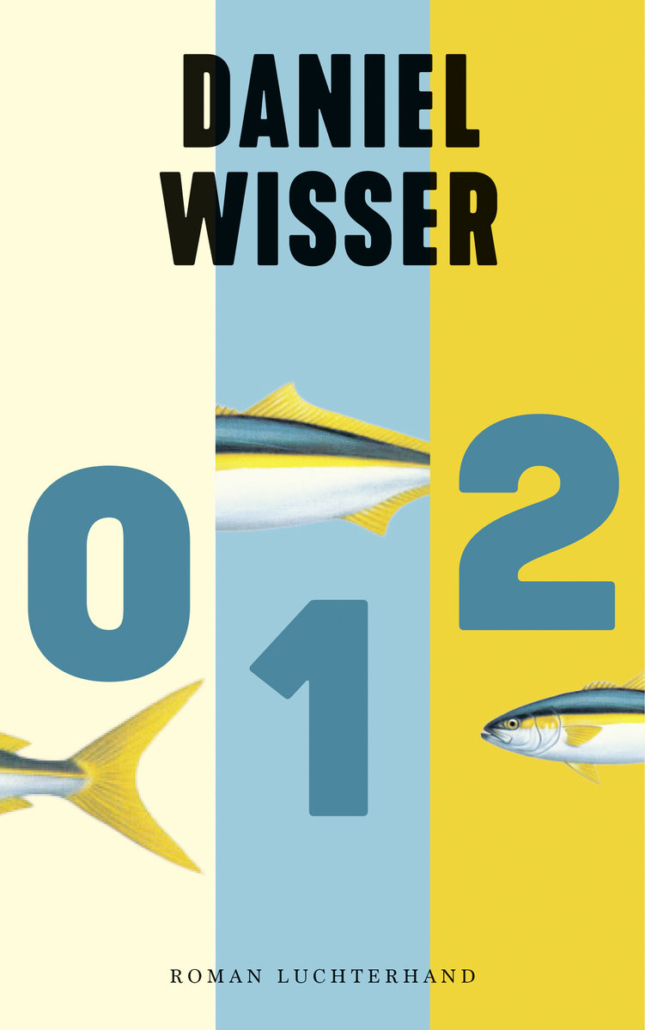
Daniel Wisser: 012
Luchterhand Verlag
450 Seiten
€ 26,50