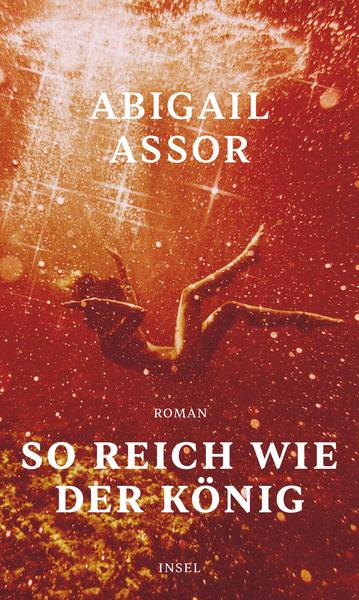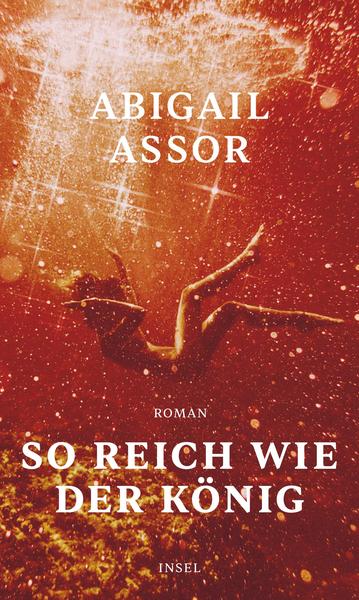Ein halbes Jahr Musik
Musik-Streaming – Wie sich meine Hörgewohnheiten nach einem halben Jahr veränderten.
Text: Helmut Schneider
1976 gründete Richard Branson seinen ersten Plattenladen in der Londoner Oxford Street. In den 90er-Jahren – am Höhepunkt der CD-Welle – gab es in hunderten Ländern Virgin Megastores mit einem breiten Angebot an Musikträgern, auch in Wien existierte bis 2004 ein komfortabler Laden in der Mariahilfer Straße. Heute sind nur noch Reste des Megastore-Imperiums übrig, bekanntlich verdient der britische Milliardär und Abenteurer sein Geld heute unter anderem mit Weltraumtouristen. Denn wer Musik hören will, bedient sich jetzt meist eines Steamingdienstes.
Lange Zeit dachte ich, das wäre nichts für mich – vor allem weil ich der Qualität der Wiedergabe misstraute. Seit einem halben Jahr bediene ich mich nun eines Netzwerkplayers von NAD und eines Abos des angeblich hochwertigsten Musikstreaminganbieters Tidal. Das kostet bei Master-Qualität 20 Euro im Monat – aber sonst würde ich mich wohl jeden Tag fragen, warum ich mir in den Jahren eine hochwertige LINN-Anlage mit B&W-Boxen angeschafft habe. Wahrscheinlich werde ich nie wieder CDs kaufen, denn die Streaming-Qualität ist wirklich beachtlich. Bei Schallplatten sieht die Sache allerdings anders aus. Da schätze ich nach wie vor den „wärmeren“ Sound von Pressungen – vor allem von jenen vor dem Beginn der Digitalisierungswelle – ich kaufe daher fast ausschließlich gebrauchte Platten.
Was sich am meisten geändert hat, sind allerdings meine Hörgewohnheiten. Ich mag beispielsweise Filmmusik. Der amerikanische Komponist Bernard Herrmann (1911-1975) ist für mich in diesem Bereich der Maßstab, kaum jemand kommt an ihn, der die großen Hitchcock-Erfolge oder Scorseses „Taxi Driver“ komponierte, heran. Ein Genre, das wohl nicht so viele Menschen schätzen, denn nicht alles ist auf CD lieferbar oder kostet viel Geld. Auf Tidal steht nun wirklich viel von ihm auf Abruf bereit. Zum Vergleich schaue man sich auch an, wie wenig vom zurzeit wohl besten Filmkomponisten Thomas Newman auf CD oder Vinyl bei Amazon oder jpc.de angeboten wird. Mein Lieblingsscore „Angels in America“ ist überhaupt nicht verfügbar, auf Tidal aber sehr wohl.
Das „auf Abruf“ ist für mich übrigens auch nicht unwichtig, denn wer viele CDs besitzt (und nicht sehr ordentlich ist), findet das Gesuchte nicht immer gleich. Aber natürlich: kein Vorteil, wo nicht auch ein kleiner Nachteil wäre. Dadurch, dass man mit einem Antippen sofort zum nächsten Titel springen kann, muss man sich zur Geduld, die nötig ist, um ein größeres Werk zu genießen, verpflichten. Deshalb habe ich mit ein paar Ausnahmen auch weniger Klassik als sonst gehört. Natürlich nahm ich mir vor, die verschiedenen Interpretationen eines Lieblingsstück wie etwa Monteverdis Marienvesper zu vergleichen – was jetzt problemlos möglich wäre – aber irgendwie kam es bislang nicht dazu. Dafür lief etwa das neue Album von Igor Levit (On DSCH) in Dauerschleife. Auch das Jazzrepertoire ist wirklich beachtlich, da werden sich wohl nur echte Nerds beschweren können.
Wie alle Streamingdienste arbeitet natürlich auch Tidal mit Algorithmen, das heißt die wissen genau, was ich wie lange höre und schlagen mir Ähnliches vor. Was mir aber oft wirkliche Entdeckungen beschert. Gut sind auch die Funktionen wie Liedtexte zum Mitlesen oder diverse Kurzbios der Künstler. Jetzt weiß ich etwa, dass der Filmkomponist Jonny Greenwood (grad auf Netflix zu sehen ist „The Power of the Dog“) Multiinstrumentalist bei „Radiohead“ ist. Herrlich ist es aber auch im Frühwerk späterer Berühmtheiten zu stöbern, wo vieles noch wunderbar direkt oder verspielt ist. Und gut ist auch die Funktion Download von Alben, denn so lässt sich – ohne eine große Telefonrechnung zu produzieren – im Schwimmbad auf dem iphone Musik hören.
Mein Fazit: Wer wirklich viel Musik hört, für den zahlt sich das teure Abo aus, wer aber nicht so eine hohe Qualität braucht, kommt auch mit günstigeren Diensten aus.