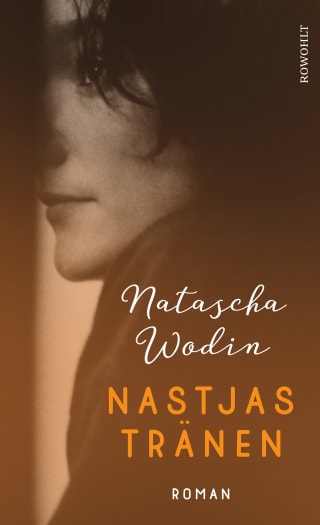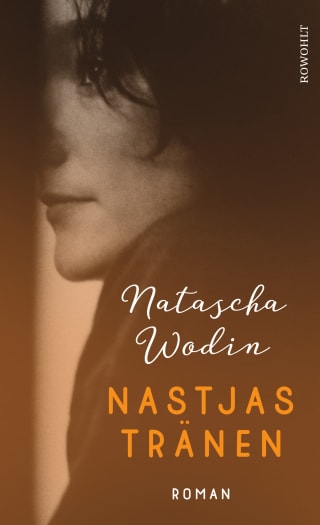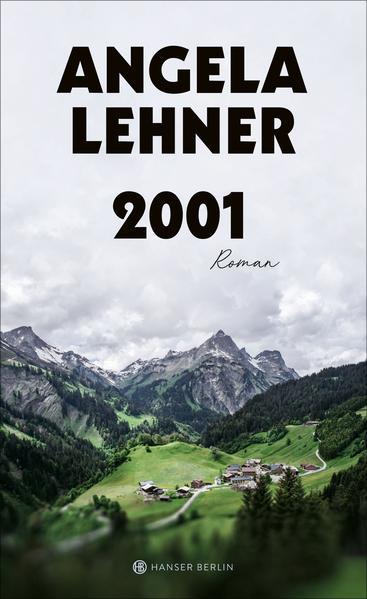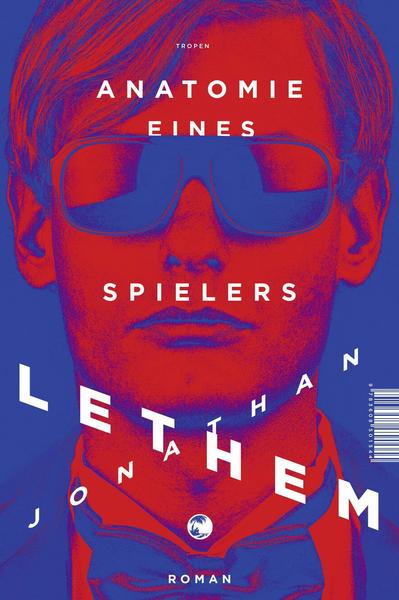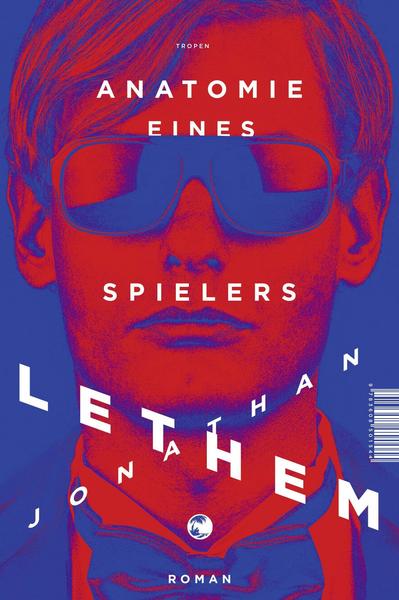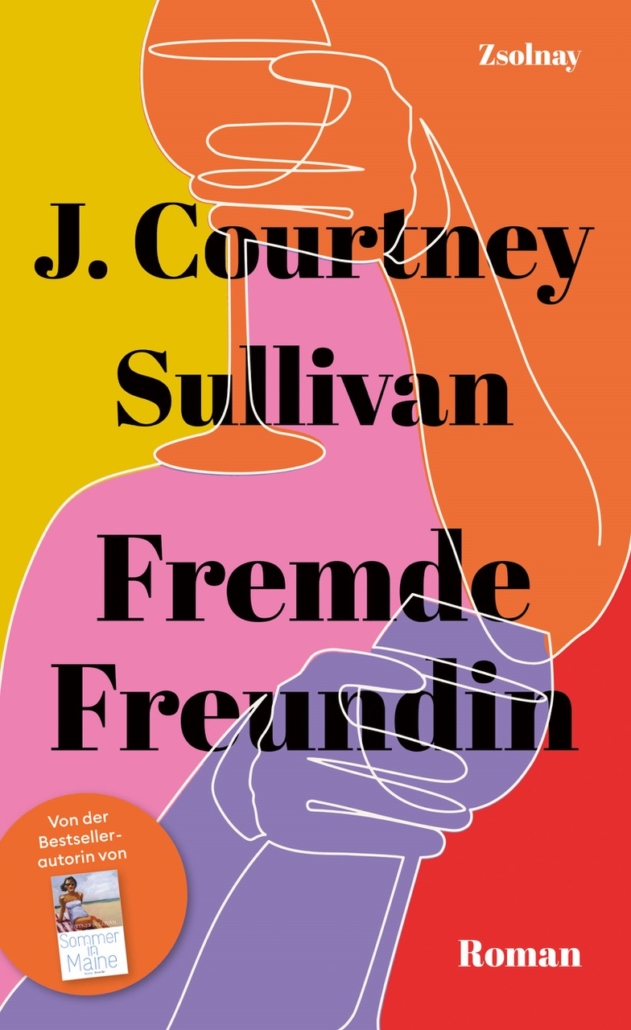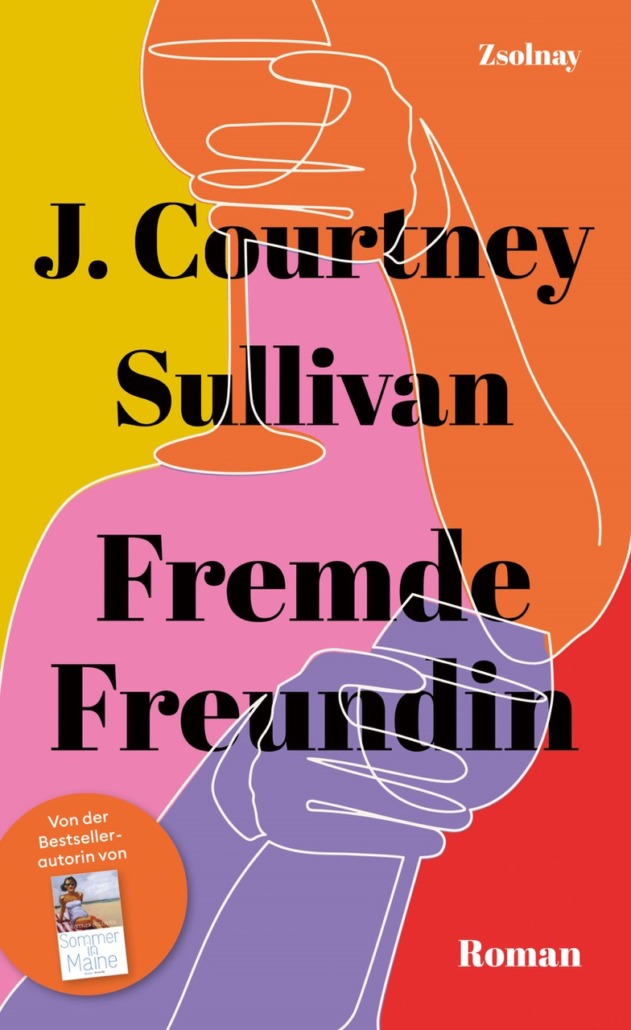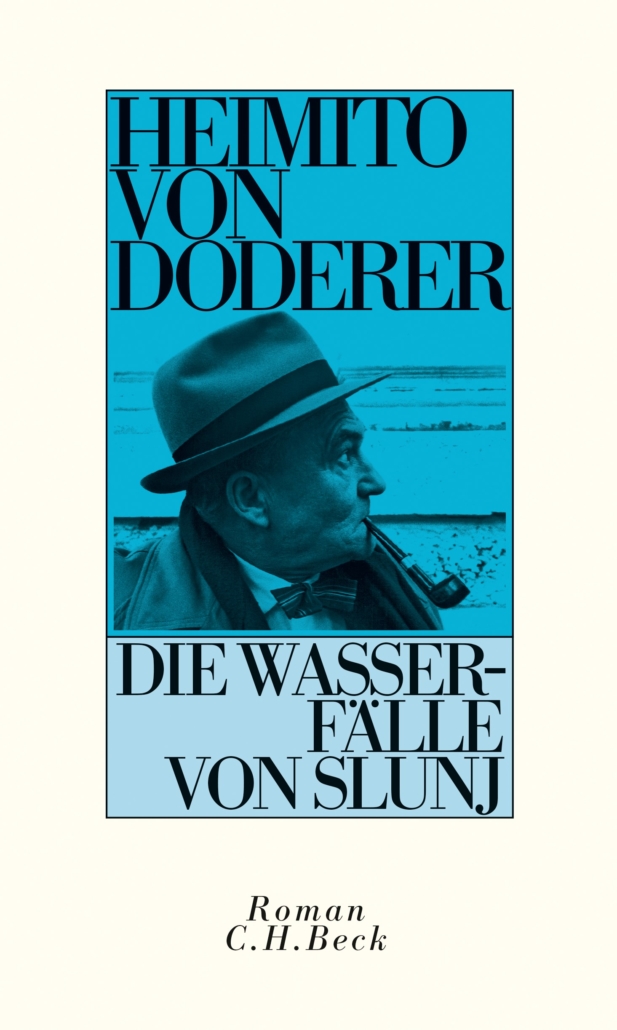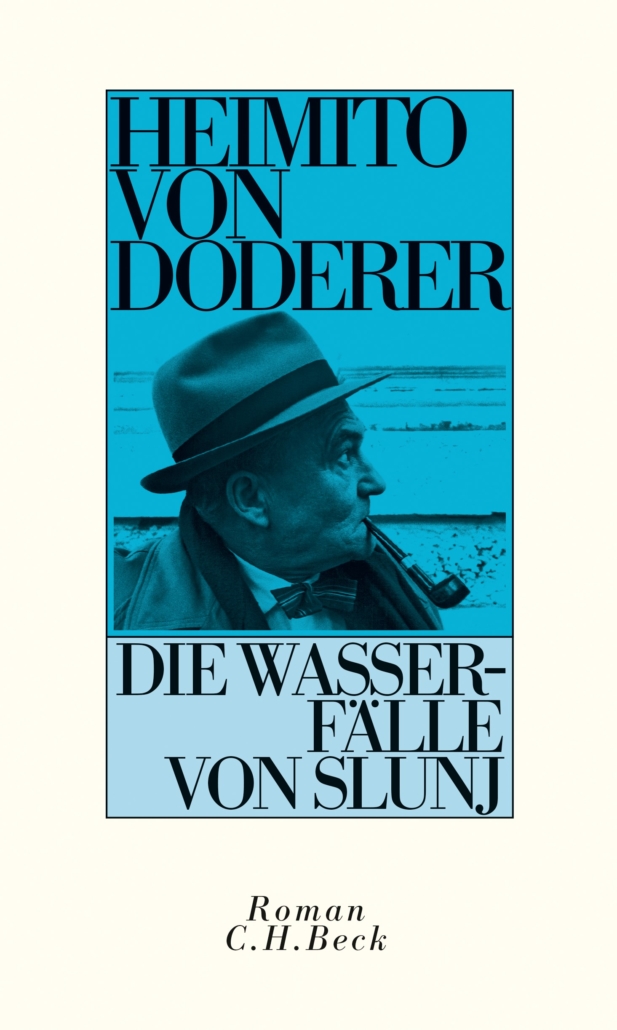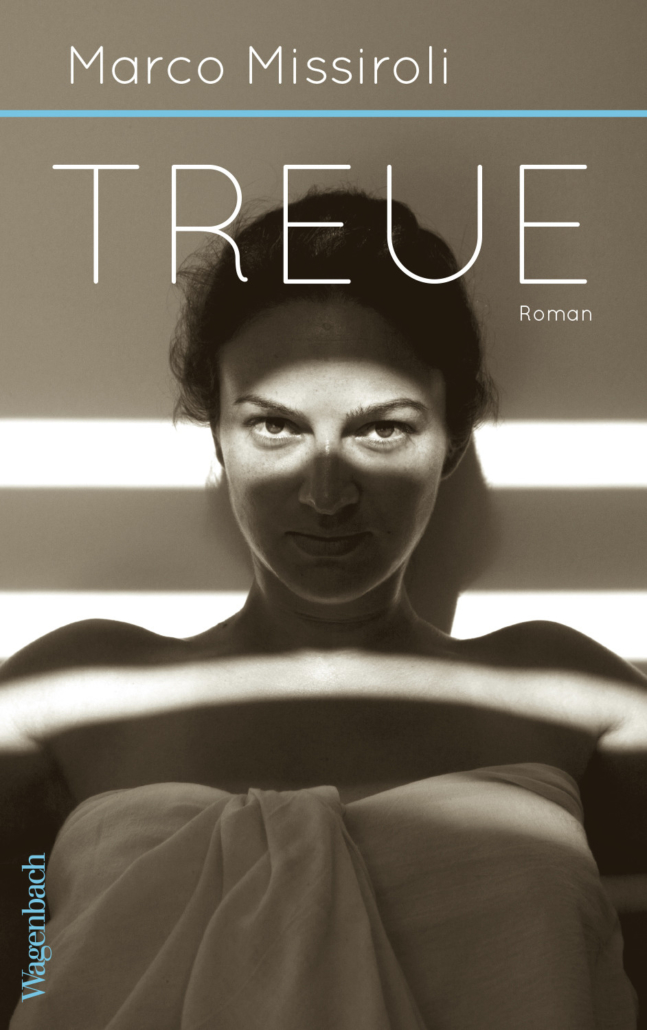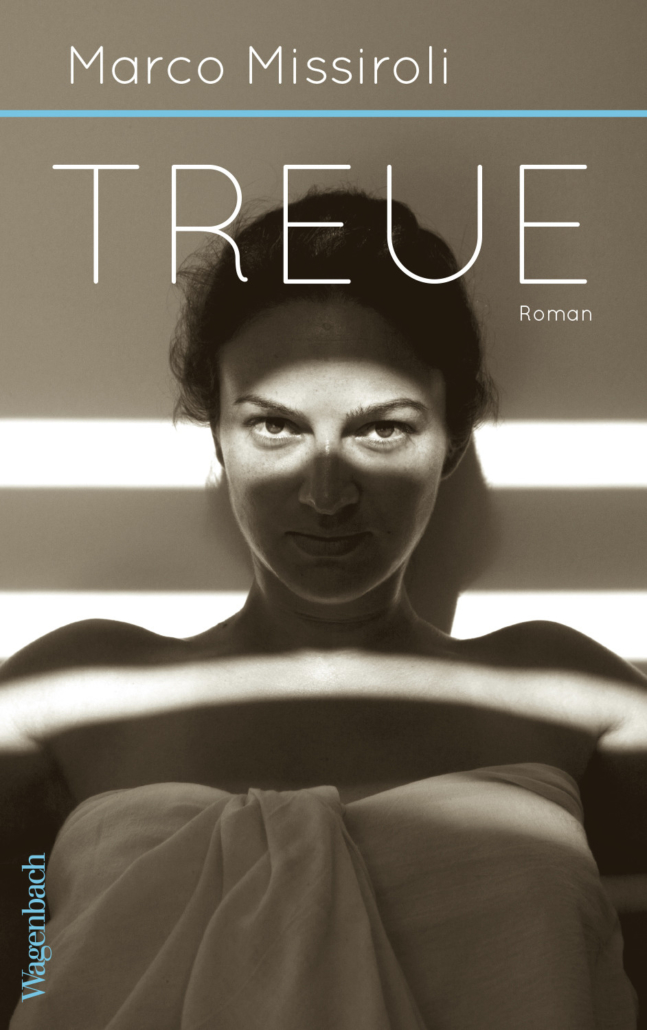WIENschräg – (Kultur)hauptstadt Salzburg
WIENschräg, der Satireblog von Walter Posch.
Text: Walter Posch / Foto: picturedesk.com
Mit der nicht übertrieben kurzen Reaktionszeit von einem dreiviertel Jahrhundert hat der Mahlstrom der Geschichte auch Salzburg erfasst und so wie in anderen europäischen Städten einen Prozess in Gang gesetzt, der gerne mit dem Begriff „Vergangenheitsbewältigung“ beschrieben wird, gleichwohl niemand so genau weiss, was da eigentlich bewältigt wird bzw. in welcher Form dieser Prozess zum Abschluss kommen sollte. Am besten endlich einmal aufhören!
Umso mehr verdient der Beschluss des Gemeinderates der Stadt Salzburg Anerkennung, sein Stadtarchiv 2008 mit der Organisation eines Projekts zu betrauen, um die NS- Geschichte der Stadt unter Einbeziehung zahlreicher Wissenschafter*innen und Expert*innen aufzuarbeiten und Entscheidungsgrundlagen für entschlossenes Handeln zu liefern: dort, wo die finstere Vergangenheit am sichtbarsten den öffentlichen Raum beherrscht, in der Benennung von Strassen und Plätzen nach nationalsozialistischen Würdenträger*innen.
Ein zu diesem Zweck eingesetzter Fachbeirat von honorigen Expert*innen mit ausgewiesener historischer, archivarischer und publizistischer Kompetenz identifizierte schliesslich 66 solcherart „belastete“ Strassennamen. Immerhin 8 dieser Personen hatte die Stadt Salzburg nach 1945 mit der Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet, und fast alle der Strassenbenennungen zwischen 1957 und 1991 fasste der Salzburger Gemeinderat einstimmig.
Diesem Tatbestand ist auch die Schwierigkeit geschuldet, die der unvoreingenommene Laie, wie oben beschrieben, mit der Fragestellung hat, in welcher Form welche Vergangenheit eigentlich bewältigt wurde bzw. wie diese fortlebt in deren Nachfahren.
Jene Schwierigkeit wird nicht gerade dadurch erleichtert bzw. behoben, dass der sogenannte Fachbeirat es sich zur Aufgabe gesetzt hat, die 66 belasteten Personen nach dem Prinzip zu kategorisieren, inwieweit diese in die NS- Geschichte „verstrickt-verstrickter-am verstricktesten“ sind, wobei nicht eindeutig zu erkennen ist, wie diese Kategorien voneinander abgegrenzt wurden, in welche die belasteten Personen eingeteilt wurden. Eindeutig sind bloss die Handlungsempfehlungen, mit denen die Expert*innen nach mehrjähriger Forschung und Beratung ihren Kopf geschickt aus der Schlinge gezogen haben:
Kat.1: Nicht gravierende Verstrickung bedeutet nur einen Eintrag im digitalen Stadtplan auf der Website der Stadt Salzburg.
Kat.2: Gravierendere Verstrickung bedeutet zusätzlich eine Erläuterungstafel zum Strassennamen.
Kat.3: Gravierende NS- Verstrickung bedeutet Diskussions- und Handlungsbedarf für die politischen Entscheidungsträger*innen (sic!), ob nicht eine Umbenennung in Erwägung gezogen werden solle!
Derart mit über 1000 Seiten Information, zahlreichen Publikationen und Vortragsreihen und eben jenen „Empfehlungen“ ausgestattet, entscheidet demnächst der Salzburger Gemeinderat über seine zu bewältigende Vergangenheit und damit auch die heikle Angelegenheit, wem der 13 in Kategorie 3 gereihten Ehrenmänner – es sind ausschliesslich Männer! – die Ehre in der Form abhanden kommen soll, dass ihre Strasse umbenannt wird – oder auch nicht!
Denn die Sache ist noch keineswegs entschieden, und die öffentliche Meinung oszilliert breit zwischen der Position des KZ-Verbandes, alle „braunen“ Strassen umzubennen, und jener der Bürgermeisterpartei, keiner einzigen die Ehre des Namenspatrons abzuerkennen. Befinden sich doch unter den 13 gravierend „Verstrickten“ sehr illustre Namen wie der des Heimatdichters Karl Heinrich Waggerl, des Domorganisten und Professors am Mozarteum Franz Sauer, Hitlers Lieblingsbildhauers Josef Thorak, der schon 1950 mit einer Ausstellung im Rahmen der Salzburger Festspiele öffentlich rehabilitiert wurde, des Komponisten Hans Pfitzner und der des weltberühmten Dirigenten Herbert von Karajan. Auffällig ist vor allem, dass alle 13 schwer „Verstrickten“ Kulturschaffende waren mit der einzigen Ausnahme des Konstrukteurs Ferdinand Porsche, den die Ehraberkennung allerdings selbst posthum vermutlich weniger schmerzen würde, fahren doch seine Gefährte höchst erfolg- und prestigereich rund um die Welt.
Dass die delikate Angelegenheit die Salzburger Lokalpolitiker*innen schwer fordern würde, war schon in der Gemeinderatssitzung vom 22. September spürbar, deren Bedeutung noch dadurch augmentiert wurde, dass diese auch im Internet übertragen und damit der ganze Planet Zeuge eines welthistorischen Ereignisses wurde.
Eine besonders irritierende Interpretation von Vergangenheitsbewältigung lieferten dabei die NEOS, die der Umbenennung von Strassennamen nichts abgewinnen können, weil das gleichsam einer Auslöschung der Geschichte gleichkäme, dafür das Problem mit der Anbringung erklärender Zusatztafeln lösen und quasi kompensatorisch die monumentalen Statuen des Bildhauers Thorak, unter anderen Paracelsus, denkmalstürmend aus dem Kurgarten entfernt wissen wollen.
Im wesentlichen teilen den Standpunkt mit den Zusatztafeln – ganz zeitgeistig neben analogen Tafeln solche mit QR-code – auch die anderen bürgerlichen Parteien ÖVP und Liste SALZ, die ebenso Umbenennungen der Strassen ablehnen und die Vergangenheit lieber mit Zusatztafeln bewältigt wissen wollen.
Nicht ganz unerwartet stösst die FPÖ in ein ähnliches Horn, wobei die Bemerkung des Gemeinderates Heindl aufhorchen lässt, dass „Opfer vielleicht ab und zu froh sind, wenn sie Tätern verzeihen können.“
So wird der Vorstoss der Grünen, Strassen umzubenennen, wohl keine Mehrheit finden, zumal die in dieser wichtigen Causa positionslose und blasse SPÖ dem ihrer Meinung nach „weit über die Landesgrenzen hinaus anerkannten Salzburger Modell“ mit den Erklärungstafeln vermutlich ihre Zustimmung geben wird.
So gesehen ist es ex post ein Glücksfall, dass niemand in der Nazizeit auf die Idee gekommen ist, den Elisabethkai zur Erinnerung an Himmlers Salzburgbesuch im Jahre 1938 in Heinrich-Himmler-Gedächtnispromenade umzubenennen. Die Vergangenheitsbewältigung wäre schier unmöglich gewesen.
Ob nun mit oder ohne Zusatztafel, der inkriminierte Herbert von Karajan hätte jedenfalls das Dirigat des diesjährigen Don Giovanni der Salzburger Festspiele nicht angenommen, dessen Premierenpublikum einer Inszenierung frenetisch applaudierte, dessen Regisseur die Interpretation nicht verständlicher Szenen gar in die Obsorge des Unterbewusstseins des Publikums entlässt und der Festspielpräsidentin Tränen der Rührung entlockte, weil zahlreiche Salzburger Frauen als Statistinnen teilgenommen hatten.
Vergangenheit hin, Bewältigung her, ganz gleich, welches Auto da vom Himmel fiel, es war kein Porsche! Das hätte sich der Porsche-Enthusiast Karajan verbeten.