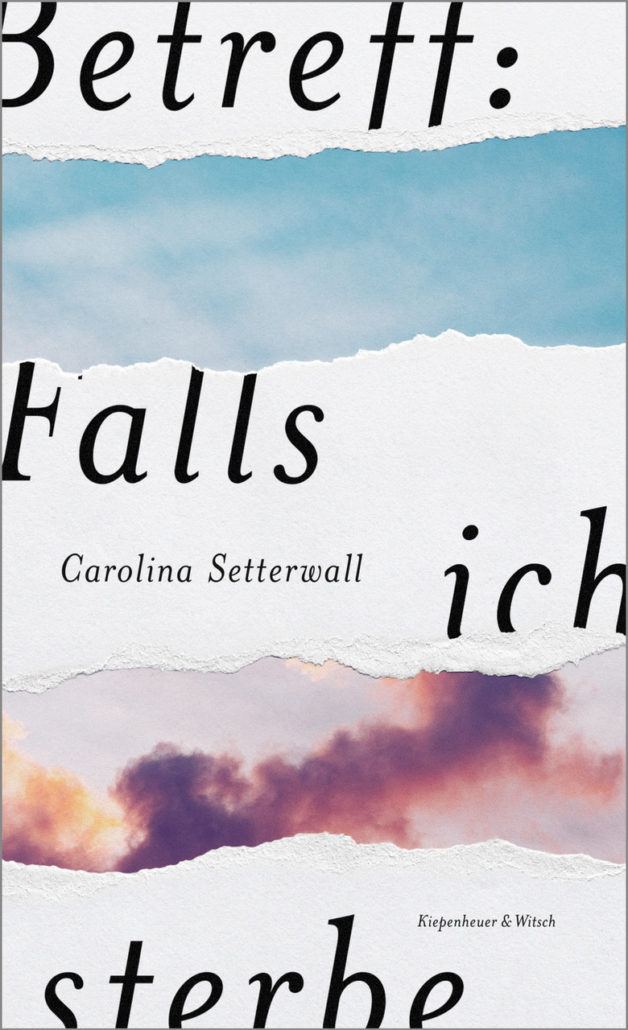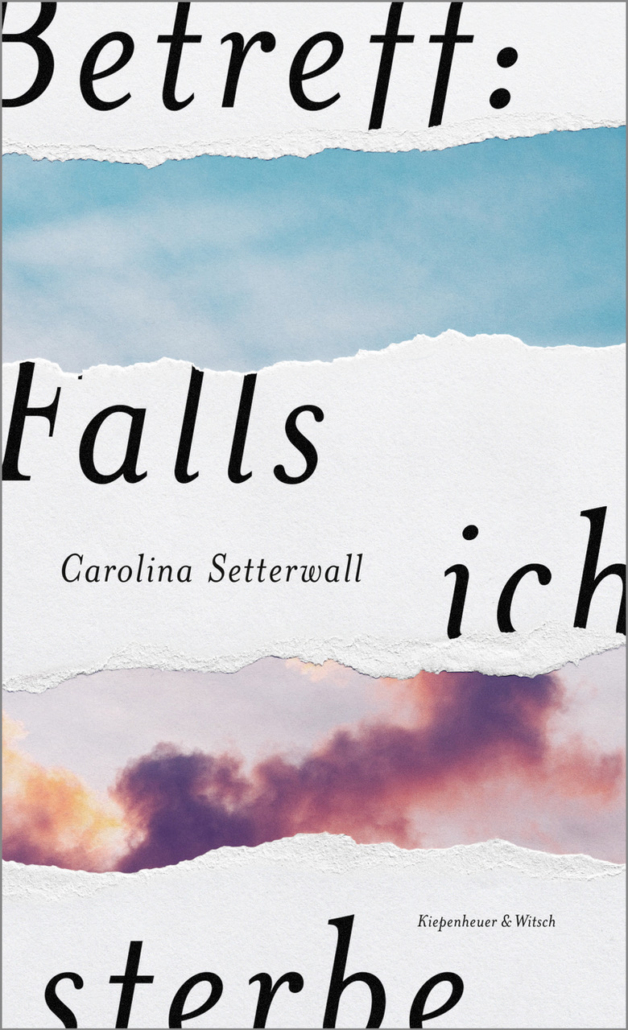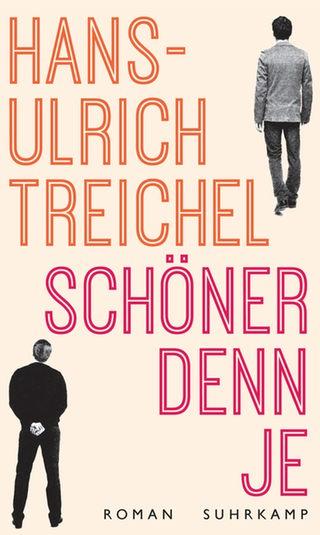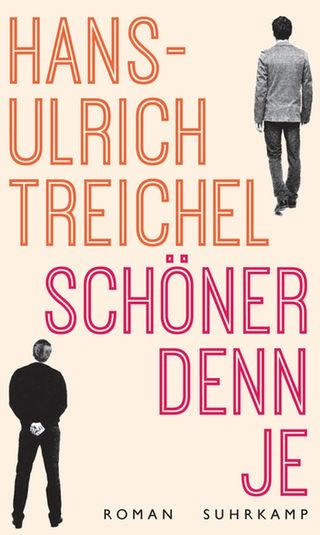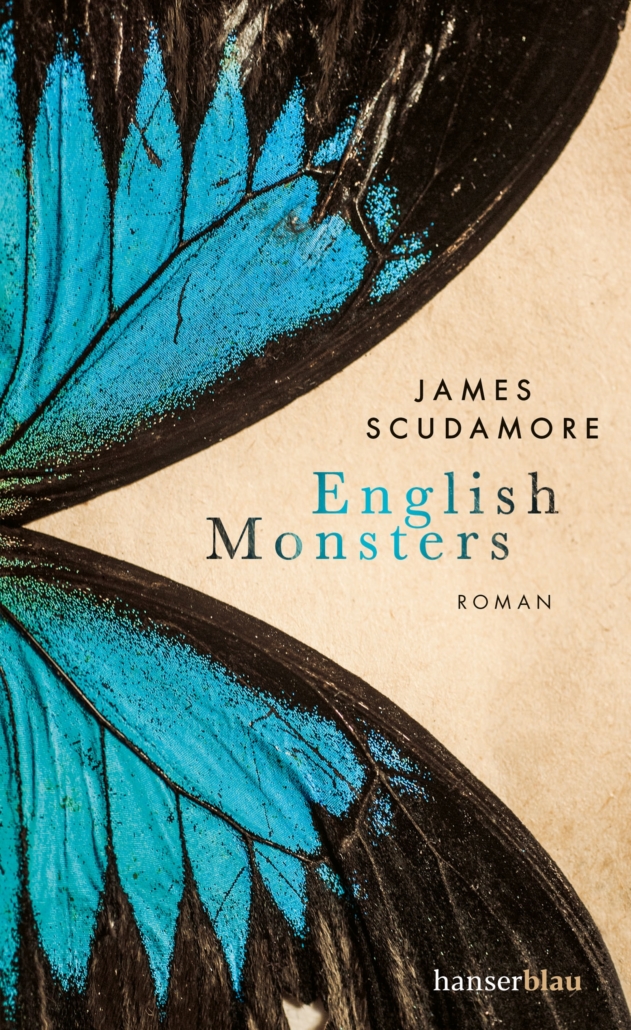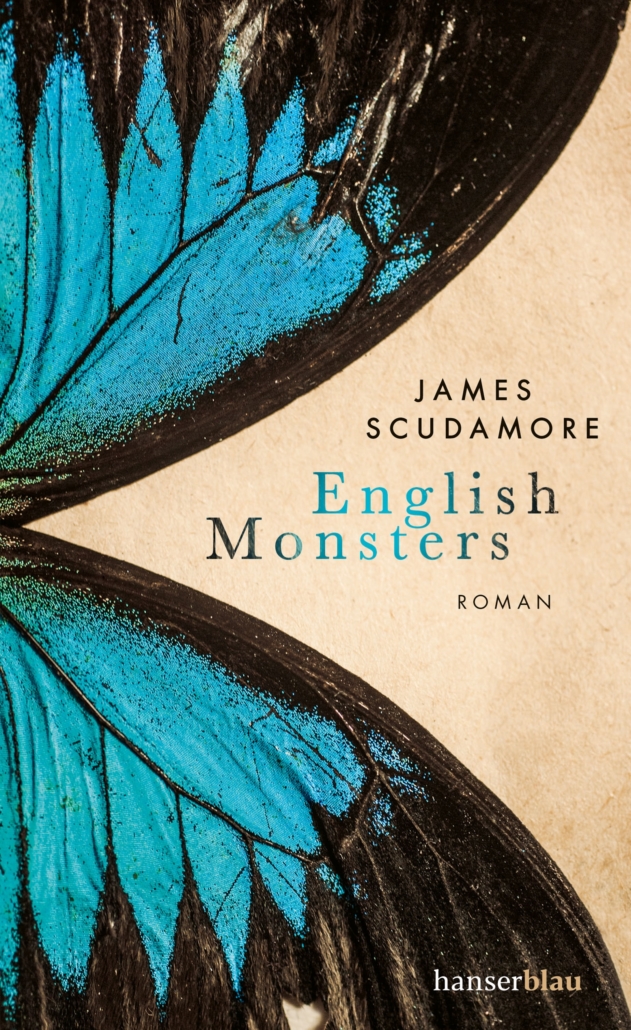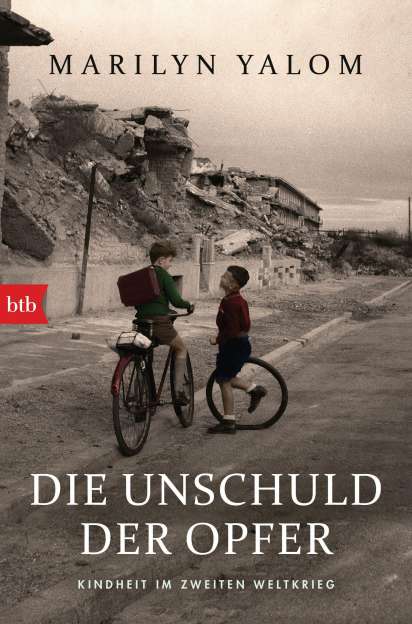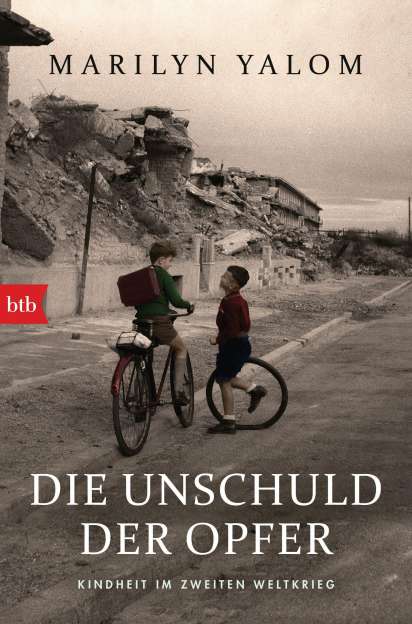Buchtipp – Reinhard Tötschinger, Rochade
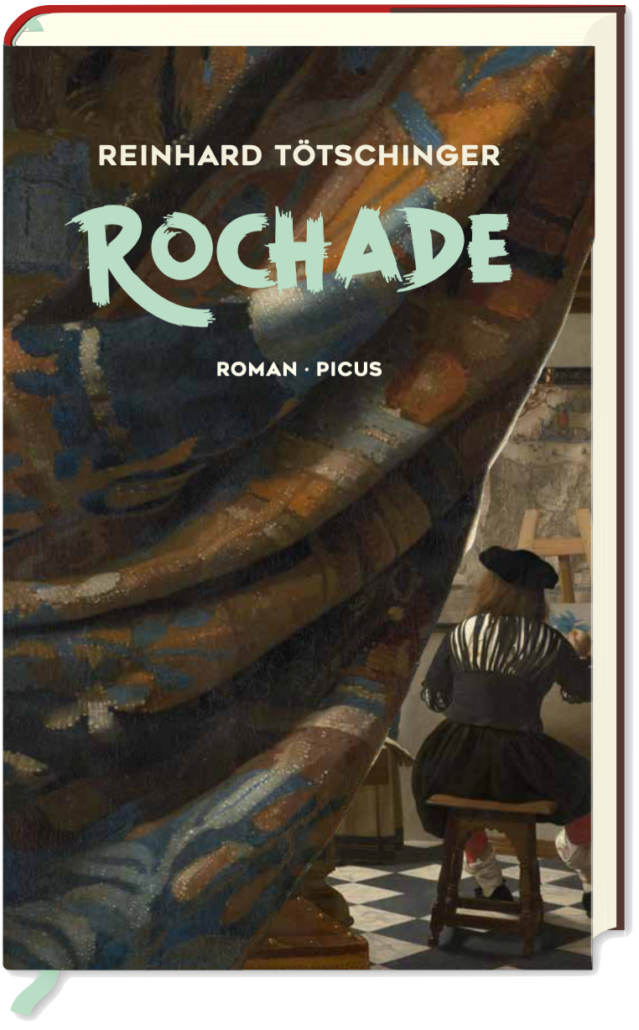
Im Talk mit Jan Vermeer – Reinhard Tötschingers Fälscherroman „Rochade“
Als eines der berühmtesten Gemälde des Kunsthistorischen Museums – Jan Vermeers „Die Malkunst“, das man nach Amsterdam verliehen hatte, bei einem Anschlag ebendort beschädigt wird, muss natürlich der Chefrestaurator Clemens Hartman mit äußerster Sorgfalt vorgehen. Allein, der junge Kanzler der Republik – der mit den gegeelten Haaren – will das Gemälde so schnell wie möglich wieder vollkommen wiederhergestellt in seinen Amtsräumen haben. Und so greift Clemens gemeinsam mit seinem pfiffigen Assistenten Hubert zu einer List. Sie wollen „Die Malkunst“ mit der gebotenen Ruhe zu Hause fertig restaurieren und dem Kanzler eine schnell hergestellte Kopie unterjubeln.
Der Unternehmensberater und Psychotherapeut Reinhard Tötschinger hat schon Theaterstücke und Essays geschrieben, „Rochade“ ist nun sein Romandebüt. Eines, das sich sehen lassen kann. In die sehr witzig geschriebene Geschichte einer Fälschung flechtet er historische Erzählungen über die vielen Besitzer dieses berühmten Vermeers ein. Das Gemälde galt nämlich als eines von Hitlers Lieblingsbildern – als Österreich annektiert wurde, schaffte man es nach Deutschland, wo es zum Prunkstück des Führermuseums werden sollte. Und Tötschingers Erzähler Clemens Hartmann hatte einen Großvater, der als Kunstkurator zeitweise in Hitlers Diensten stand.
Die Spannung ergibt sich klarerweise dann dadurch, dass wir bis zum Ende nicht wissen, ob der Schwindel mit der Fälschung durchgehen wird. Zudem wird das Kunsthistorische gerade von einem Unternehmensberater heimgesucht, der von Kunst keine Ahnung hat, sich aber überall einmischt und bald schon Kündigungen verlangt. Alles muss schneller und billiger gemacht werden. Die üblichen Verwerfungen bei einer neoliberalen populistischen Regierung. Als Leser wünscht man sich, Tötschinger hätte auch die Nebenfiguren besser charakterisiert. Wir bekommen gerade noch den interessanten Assistenten Hubert zu fassen, die Tochter Hartmanns scheint allerdings nur angedeutet. Dafür bleibt aber das Vergnügen, Jan Vermeer himself kennenzulernen, denn Hartmann spricht bald schon mit dem Meister, der ja auch im Bild selbst – allerdings eben nur von hinten – zu sehen ist, und der dann auch antwortet. Vermeer will übrigens schleunigst wieder im Museum ausgestellt werden, wo er sich an den hübschen Touristinnen erfreuen kann…
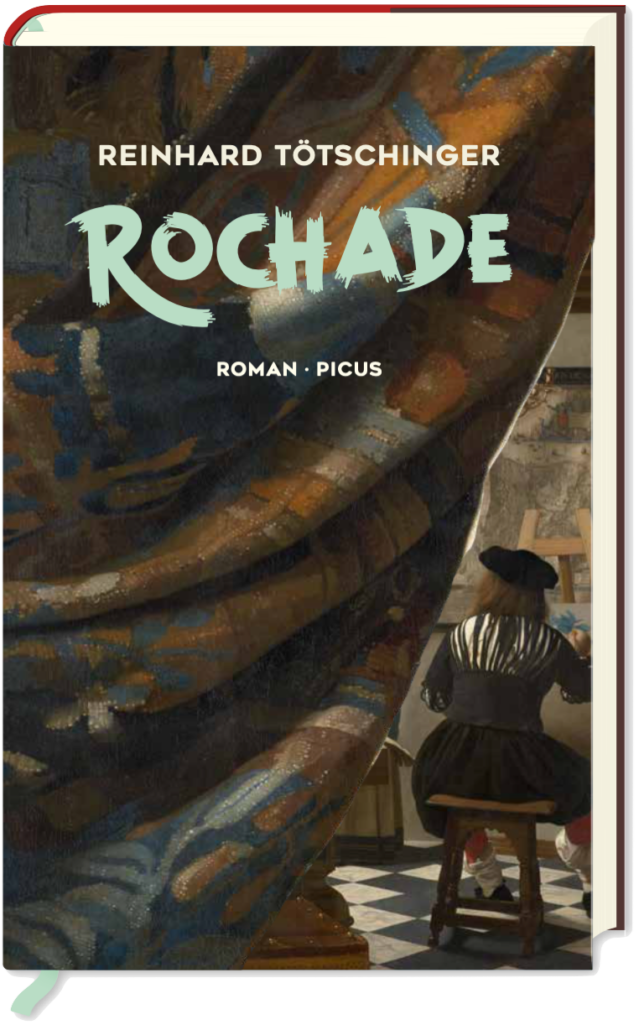
Reinhard Tötschinger: Rochade, Picus Verlag
ISBN: 978-3-7117-2109-9
288 Seiten, € 22,–