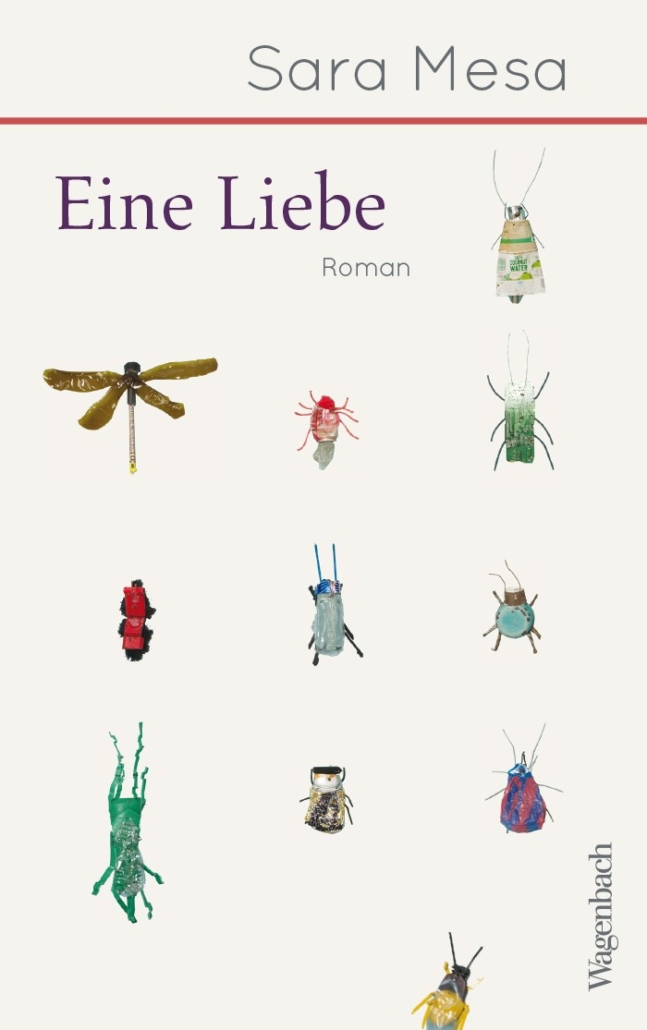Die Männer auf den Bohrinseln – Tabitha Lasleys „Seegang“
Wie geht es Männern, die wochenlang keine Frauen um sich haben und auch sonst völlig abgeschieden leben müssen? Das fragt sich die Journalistin, Autorin und Ich-Erzählerin in Tabitha Lasleys „Seegang“. Sie verlässt – nachdem ein Romanmanuskript einem Einbruch zum Opfer gefallen ist – ihren Freund, um im schottischen Aberdeen Interviews mit Erdölplattformarbeitern zu führen. Gleich mit dem ersten Interviewpartner geht sie eine Beziehung ein, obwohl der natürlich wie fast alle Offshore-Arbeiter verheiratet ist. Wie sie das Ende der seltsamen Liebe verarbeitet und wie die Stimmung in einer nur durch die Erdölindustrie reich gewordenen Stadt funktioniert – davon handelt dieses Buch, das sich nicht so richtig als Roman titulieren lässt.
Die harte und gefährliche Arbeit auf den Plattformen war lange Zeit noch die einzige Möglichkeit für die Arbeiterklasse in Großbritannien, ein Zipfelchen vom Wohlstand zu erreichen. Mit dem Verfall des Ölpreises sowie der Konkurrenz billiger, rechteloser Arbeitskräfte aus Rumänien stellt sich die Situation heute wieder anders dar. Lasley führte mehr als hundert Interviews in denen sich ihr meist ein ähnliches Bild zeigte. Die Männer, die meist nach drei Wochen Heimurlaub bekommen, wirken völlig entwurzelt und können zu Hause kaum noch Tritt fassen. Der Alkohol – den es auf den Bohrinseln natürlich nicht gibt – beherrscht in Aberdeen den Alltag, man will nachholen, was man versäumt hat. Kaum einer kann sein Familienleben aufrechterhalten.
Die Erzählerin ist mittendrin in dieser seltsamen Gemeinschaft. Da sie ihre Interviewpartner meist in Bars findet, hält sie sich dort öfters auf als ihr guttut. Der unfreundliche Winter von Aberdeen und das schlechte Viertel in dem sie wohnt tun ein Übriges. Am Ende arbeitet sie in einem Schnellimbiss in einer trostlosen Nachbarschaft.
Tabitha Lasleys „Seegang“ ist ein Buch über die Situation der britischen Gesellschaft, man bekommt als Leser auch ein Gefühl dafür, warum der Brexit wohl kein Betriebsunfall der Politik des Landes war.

Tabitha Lasley: Seegang
Aus dem Englischen von Tanja Handels
Luchterhand Verlag
320 Seiten
€ 22,70