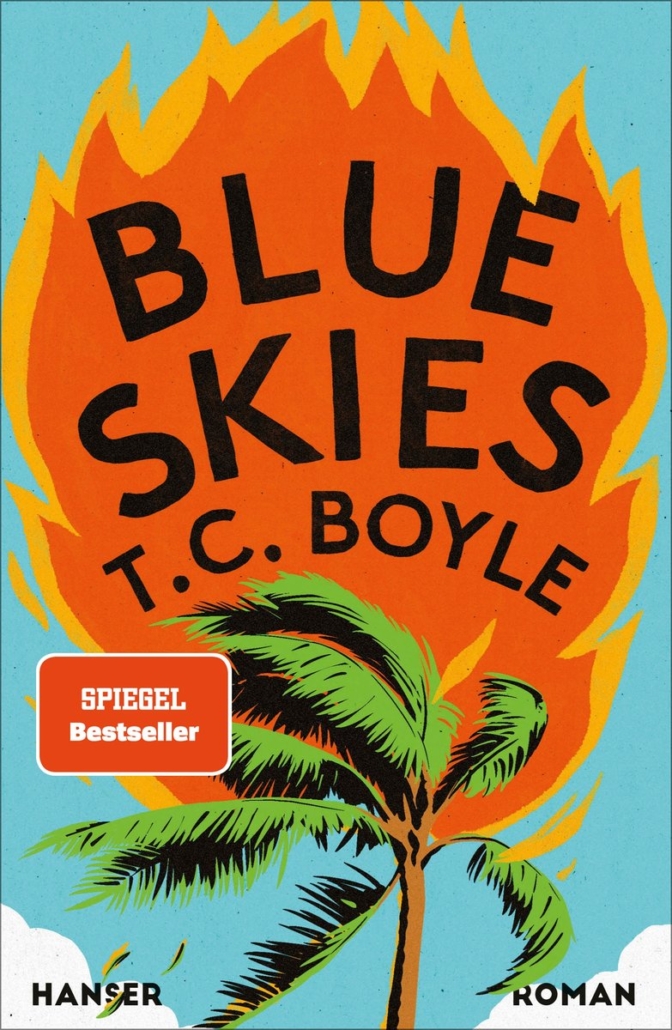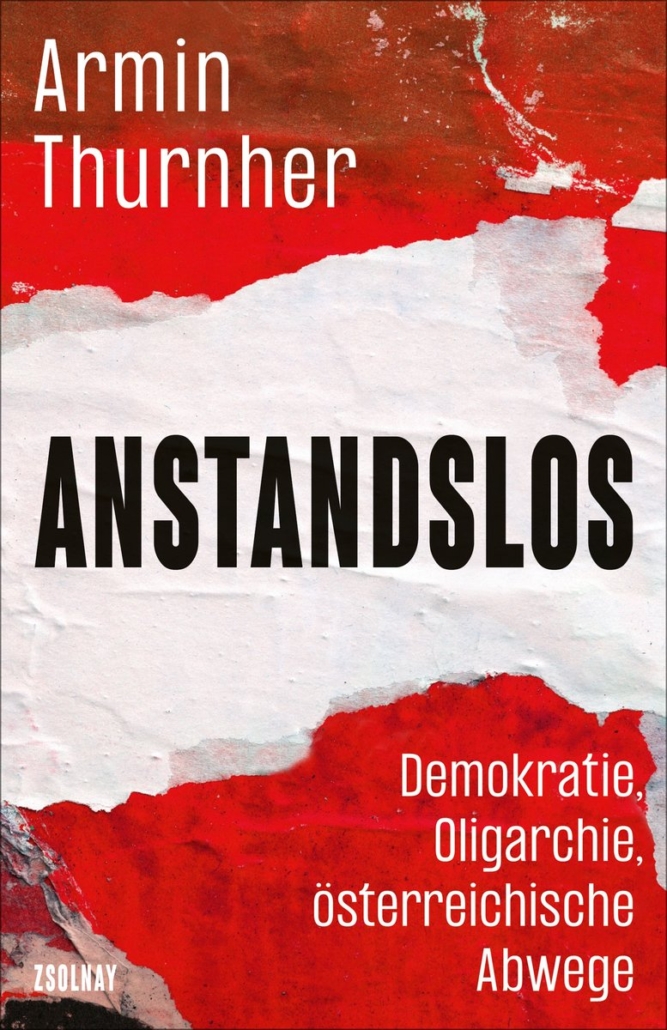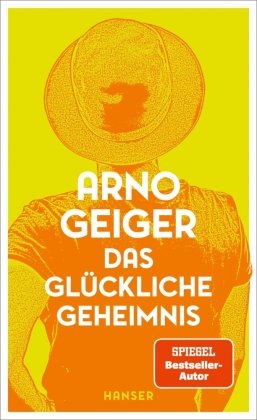Mit dem Roman „Es geht uns gut“, der 2005 den Deutschen Buchpreis gewann, wurde der in Wien lebende, in Vorarlberg geborene Autor Arno Geiger international bekannt. Seit Buch über seinen alzheimerkranken Vater „Der alte König in seinem Exil“ wurde 2011 zu einem Bestseller. In seinem neuen Buch „Das glückliche Geheimnis“ berichtet Geiger von seiner jahrzehntelang gepflegten Leidenschaft, in Altpapiercontainern nach Briefen, Tagebüchern und Handschriftlichem zu suchen. In einem Interview, geführt im Rüdigerhof, gibt Arno Geiger Auskunft über sein Schreiben und Leben in Wien.
„Das glückliche Geheimnis“ ist ein sehr persönliches Buch. Nie ist in Frage gestellt, dass das „ich“ im Text der Autor ist. War das eine Überwindung, so etwas zu veröffentlichen?
Nein, ich habe das immer als sehr befreiend empfunden, wenn jemand offen erzählt von dem, was ihm in seinen Leben zustößt – weil wir profitieren natürlich vom Austausch.
Sie haben aber sicher als bekannter Autor Erfahrungen gemacht mit einer nicht immer passenden Distanz zu den eigenen Lesern. Jeder/Jede will sein/ihr Buch signiert haben, obwohl er Sie persönlich natürlich nicht kennt.
Die Distanz, die bleibt bestehen. Durch diese Transformationen der Literatur – es ist ja nicht gelebtes Leben, das ich nach außen trage, sondern in Worte gefasstes. Und wir wissen ja, dass eine gemalte Orange etwas anderes ist als eine echte Orange.
Mich hat immer fasziniert, wenn man das Werk eines Schriftstellers liest, vermeint man, ihn zu kennen – was natürlich falsch ist.
Ich denke viel darüber nach, was es heißt, sich preiszugeben. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto plausibler kommt es mir vor, dass die Fragen mehr werden und nicht weniger. Das Geheimnis Mensch wird in Wahrheit nicht kleiner, wenn ich viel preisgebe. Vielleicht ist das genaue Gegenteil der Fall. Jemand der sich komplett abschottet, der ist eigentlich langweilig. Jemand der im Auskunft-geben über sich selbst äußerst zurückhaltend ist oder sich selbst stilisiert – das finde ich platter und weniger Fragen-aufwerfend, als wenn jemand einmal die Tür aufmacht. Wie Sokrates sagte: Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich auch, wie wenig ich weiß. So ist das vielleicht auch, wenn ich von mir selber erzähle, dann denke ich mir, ja die Menschen wissen mehr, aber sie wissen auch mehr, wie wenig sie wissen. Weil das Geheimnis Mensch tiefer wird. Genau darum geht es beim Schreiben – dass ich tiefer hinabsteige, dass das Geheimnis Mensch in der Tiefe ausgelotet wird und nicht an der Oberfläche. Indem ich schreibe, verwandelt sich mein Leben in Literatur. Eine Autobiografie ist eine Form von Geschichtsschreibung, aber die allersubjektivste.
Das Buch hat wohl bewusst keine Genrebezeichnung wie Roman oder Autobiografie.
Das war aber auch schon bei „Der alte König in seinem Exil“ so. „Das glückliche Geheimnis“ ist in gewisser Weise ein Geschwisterbuch von „Der alte König in seinem Exil“. „Das glückliche Geheimnis“ ist aber vieles, denn es geht ja nicht nur um mich als Person, sondern es geht auch um Themen.
Was hielten sie von der Bezeichnung Beichte?
Früher gab es das angesehene und traditionsreiche Genre der Bekenntnisliteratur. Beichte würde ich jetzt nicht sagen. Aber Bekenntnis in dem Sinn: Hier stehe ich und ich kann und will auch nicht anders – und Amen. Eine Beichte hat natürlich diesen stark religiösen Konnex – das spielt für mich überhaupt keine Rolle, auch weil ich hier nichts zu beichten habe.
Aber auch wenn man nicht religiös ist – man ist ja im Katholischen aufgewachsen…
Das Katholische – die Beichte – findet in einem ganz engen Raum statt, es wird geflüstert. Für mich ist das in keiner Hinsicht eine Beichte, sondern ich habe als Schriftsteller in meinem Empfinden die Verantwortung, über die Dinge zu schreiben, die mir am wichtigsten sind, und das zu sagen, was ich zu sagen habe – und das mache ich.
Sehr spannend ist das Thema Abfall. Sie bearbeiten zwar quasi den Edelabfall – Papier – aber wie Sie auch in der Einleitung schreiben: Für Archäologen ist der Abfall das spannendste. Und für einen Schriftsteller auch, denn sie haben dort ja Briefe, Aufzeichnungen, Tagebücher gefunden.
Ich habe dem Abfall wirklich viel zu verdanken. Er ist die Rückseite unserer Lebensform, der Abfall ist das in Ungnade Gefallene, das nicht mehr Benötigte, das Schwache, das Kaputte. Ich habe sowieso eine Zärtlichkeit für in Ungnade Gefallenes. Es gibt von unten her Auskunft über die Gesellschaft – nicht eine geschönte Auskunft, sondern eine sehr bunte Mischung. Es ist Zweitrangiges, Hingeschmiertes, Beiläufiges – es ist nicht artifiziell, nichts Gestelltes, sondern in einem guten Sinn Alltagsding. Und der Zugang über den Alltag – denn der Alltag sagt uns andere Dinge als Kunstwerke uns sagen –, diesen Zugang habe ich auch – nicht nur als Schriftsteller. Ich habe vor allem als Person davon profitiert. Man darf ja nicht vergessen wie jung ich war, nämlich 23/24. Ich war so neugierig und aufnahmefähig. Meine Streifzüge haben sich durch Zufall ergeben, und letztlich haben sie mich stark als Person geprägt.
Beim Lesen hat man das Gefühl, das Sammeln, die Streifzüge sind so eine Art Sucht – sie haben nicht aufhören können…
Nein, das war keine Sucht, weil dann hätte ich nicht aufgehört. Alles, was schön und bereichernd ist – das ist ja naheliegend –, dass man das gerne macht. Aber von Sucht war keine Rede. Ich erwähne das auch im Buch, dass ich zwischendurch monate-, teils jahrelange Pausen gemacht habe. Es gab oft wichtigere Dinge, zum Glück. Der Süchtige würde sich immer der Sucht unterwerfen und nicht von heute auf morgen weggehen und sagen, ich lasse das jetzt, weil gerade andere Dinge wichtiger sind. Außerdem war es immer angenehm für mich, dass es etwas war, das ich auf Knopfdruck an- und abstellen konnte.
Was hat Sie am meisten gereizt bei Ihren Streifzügen?
Besonders geschätzt habe ich, dass meine Streifzüge mir die Möglichkeit verschafft haben, Nachrichten zu bekommen über die hiesigen Sitten und Bräuche – also wie leben die Menschen? Wenn man Schriftsteller ist und vom Leben der Menschen erzählen will, ist es hilfreich, wenn man auf diesem Gebiet eine gewisse Spezialkenntnis erwirbt. Aber in der Früh musste ich immer kämpfen beim Aufstehen – weil im Bett ist es schöner.
Als Schriftsteller will man authentisch erzählen und das eigene Leben bietet nicht unbegrenzt Geschichten…
Wie die allermeisten Menschen habe ich ein Leben mit Familie, mit Freunden, mit Beruf – aber in meinem Alltag werde ich natürlich immer als der angesprochen, der ich bin, in meiner Rolle. Wir passen uns in dem, was wir sagen, immer dem Vis-à-Vis an. Ich begegne mir also in dem, was andere zu mir sagen, in gewisser Weise selber, weil es ja auf mich zugeschnitten ist. Und das konnte ich ganz geschickt umgehen dadurch, dass ich mich um Nachrichten bemüht habe, die nicht auf mich zugeschnitten sind – sondern für die beste Freundin usw. Wenn ein 14jähriger einem 14jährigen schreibt, kommt etwas anderes dabei heraus, als wenn er mir etwas erzählt.
Haben Sie wirklich so viel Persönliches gefunden? Früher hat man natürlich mehr Handschriftliches produziert, jetzt ist es fast die Ausnahme…
Ich habe einer Kultur beim Untergehen zugesehen. Das ist vorbei. Die erste Zäsur war das Telefon – dadurch ging schon vieles an Handschriftlichem verloren. Die menschliche Gesellschaft hat sich über Jahrtausende auf Papier gestützt – um Dinge festzuhalten, um Nachrichten zu übermitteln. Dann kommt das Telefon, und es bricht schon einmal die Hälfte weg. Und dann kommen Computer, E-Mail und Social Media, und es brechen weitere 40 Prozent weg. Ich habe mich diesem Metier mit geschultem Blick vermutlich gründlicher gewidmet als je ein Mensch. Es gibt natürlich andere Leute, die im Abfall etwas suchen, aber die beschäftigen sich nicht inhaltlich damit – sie machen das aus Not, während ich es aus Neigung gemacht habe.
Ich hätte vermutet, dass ein Fund von Tagebüchern eher ein Glücksfall ist…
Nein, ich habe nie auf das Glück des Dummen vertraut, ich war ziemlich beharrlich und habe mich nicht entmutigen lassen, wenn einmal monatelang nichts Brauchbares dabei war. Vieles hatte posthumen Charakter, wird also nach dem Tod eines Menschen weggeworfen wie alte Zeitungen oder zerbrochenes Spielzeug. Es stirbt jemand, und niemand blättert auch nur hinein – die Brösel der gepressten Blumen, 30, 40 Jahre alt, rieseln einem entgegen. Der Staub vom Dachboden liegt wie Verbandswatte über den Dingen – das wird einfach weggeworfen, entsorgt – ent-sorgen, sich einer Sorge entledigen, weg damit, ich brauche das nicht, ich kann das nicht einmal lesen, weil es in Kurrent ist.
Für Ihren Roman „Unter der Drachenwand“ habe Sie ja einiges Vorgefundene verwenden können, oder?
Ich verdanke vor allem als Person dem Abfall ungeheuer viel, weil ich mich entwickeln konnte in diesen Begegnungen. Und wer mehr vom Leben weiß, der hat auch mehr zu sagen. Künstler war ich sowieso schon, aber ich habe daraus Inspiration gezogen. Bei „Unter der Drachenwand“ verschaffte ich mir auch viele Briefe übers Internet. Ich wusste, dass ich diesen Roman schreiben wollte und brauchte O-Töne, um ein besseres Gespür für die Zeit zu bekommen. Der Roman selbst ist erfunden, die Charaktere sind von mir entworfen. Aber ohne das Fundament aus dem Material wäre das Buch nicht das, was es ist. Woher sonst soll ich dieses so präzise Gefühl für die Zeit haben – für den damaligen Gebrauch der Sprache? Wenn man hundert, zweihundert Briefkonvolute gelesen hat, dann merkt man, es spricht nicht nur der Mensch, sondern die Sprache spricht aus ihnen heraus. Die Konventionen der Sprache sind ja gerade im Alltagsschreiben omnipräsent. Und das ist für mich als Schriftsteller unglaublich spannend – wenn die Sprache spricht. Und zwar anders spricht als wir heute sprechen würden.
Apropos Sprache: Als Vorarlberger hat man es in Wien ja, was die Sprache betrifft, nicht leicht. Die meiste sprechen dann Hochdeutsch, denn es gibt kein Dazwischen zwischen den Dialekten.
Ja – sprachlich gesehen sind fast alle Österreicher Bayern, nur die Vorarlberger sind Alemannen. Ich musste mir in Wien ein aktives Hochdeutsch aneignen. Wir haben ja auch in der Schule Dialekt geredet. Hochdeutsch war für mich, passiv konsumiert, selbstverständlich – aber ich habe es nie gesprochen. Wie beim Englischen, brauchte ich fürs Hochdeutsche etwa 30 Prozent der Gehirnkapazität nur fürs Übersetzen aus dem Dialekt – das empfand ich in der ersten Zeit als anstrengend.
Ich vermute, dass dieser Prozess für einen Schriftsteller auch fruchtbringen ist – man muss sich schließlich notgedrungen intensiv mit Sprache beschäftigen.
Ja, genauso ist es. Ich glaube der Grund, warum so viele österreichische Schriftstellerinnen und Schriftsteller von den Rändern kommen, hat damit zu tun. Dass sie ganz früh mit Sprachnuancen konfrontiert sind und wissen, dass sie nicht verstanden werden, wenn sie dem Gegenüber sprachlich nicht entgegenkommen. Die Faszination Sprache wird im Kind eher geweckt, wenn es erkennt, dass es unterschiedliche Sprachformen, unterschiedliche Sprachnuancen gibt und dass es gar nicht so einfach ist, diese im richtigen Moment einzusetzen.
Fühlen Sie sich inzwischen als Wiener?
Ich bin geborener Vorarlberger und gelernter Wiener. Aber dieses Aufwachsen in Vorarlberg, meine Wurzeln, sind schon sehr wichtig. Dass ich sagen würde „Ich bin Wiener“ – nein. Aber ich bin sehr glücklich in Wien und schon viel länger in Wien als in Vorarlberg. Wie man so sagt „Stadtluft macht frei“. In die Großstadt zu kommen, wo einen niemand kennt, da fällt es leichter, gewissen Konventionen die Gefolgschaft aufzukündigen. Mich hat die Stadtluft tatsächlich frei gemacht. Für mich, der ich aus bäuerlich-katholischem Milieu stamme, war das ein – im schönen Sinn – harter Kontrast. Ich konnte mich hier ausprobieren als Mensch, der sich entwickelt und der nicht mehr in der Rolle gefangen ist, die ihm zugewiesen ist. Für mich war das großartig. Letztlich ist das Buch „Das glückliche Geheimnis“ auch ein Buch über Lebenswege, die nicht geradlinig verlaufen. In meinen Augen sind die nicht geradlinigen Lebenswege die besseren, weil Umwege die Ortskenntnis erhöhen. Manche Dinge muss man ausprobieren, um herauszufinden, ob das etwas für einen ist oder nicht. Nicht jede Geschichte passiert jedem.
Am 17. Jänner stellt Arno Geiger im Gespräch mit Kristina Pfoser im Akademietheater sein neues Buch vor. www.burgtheater.at