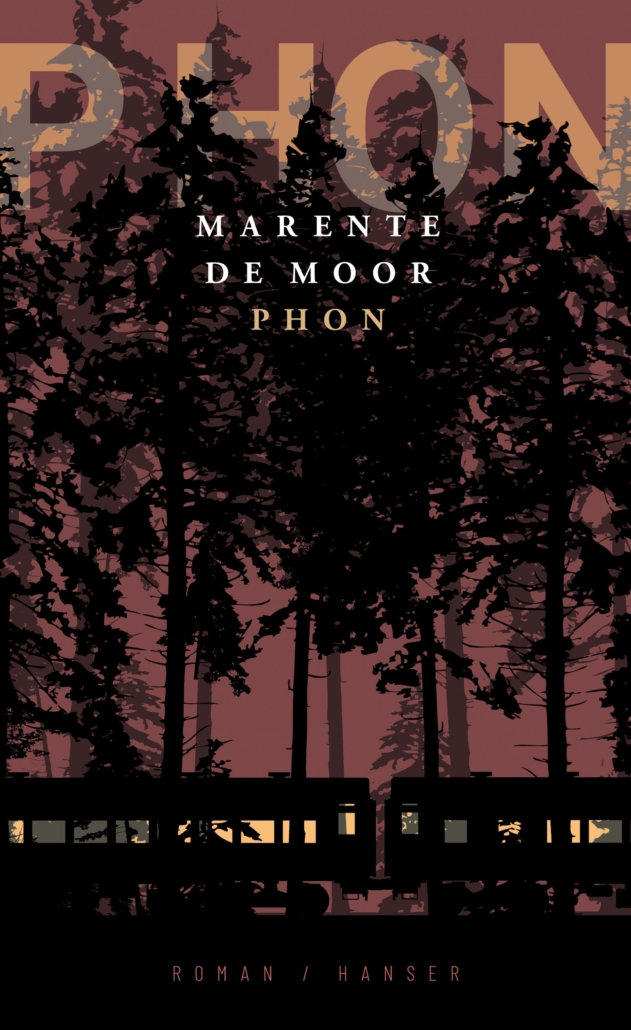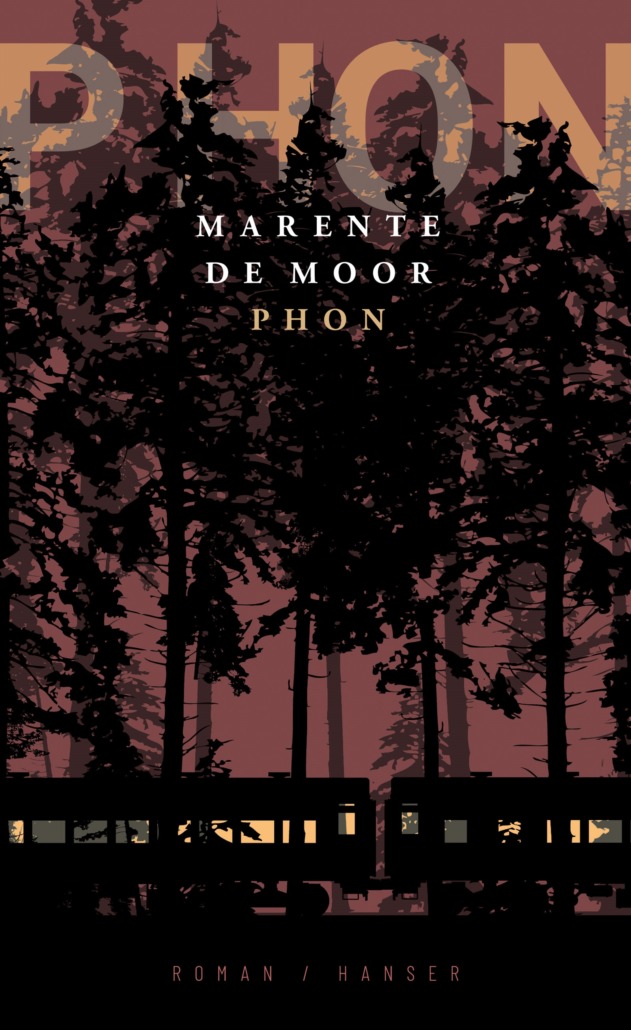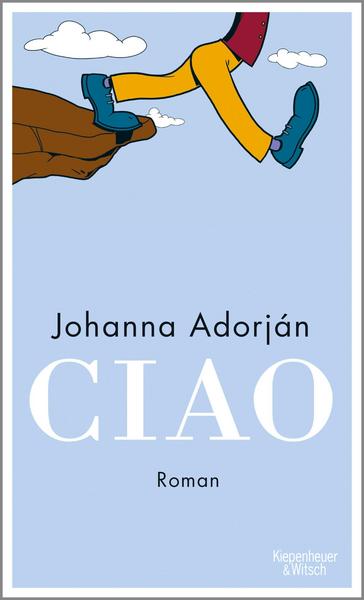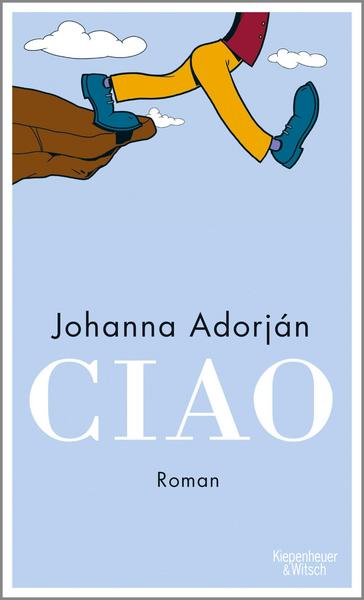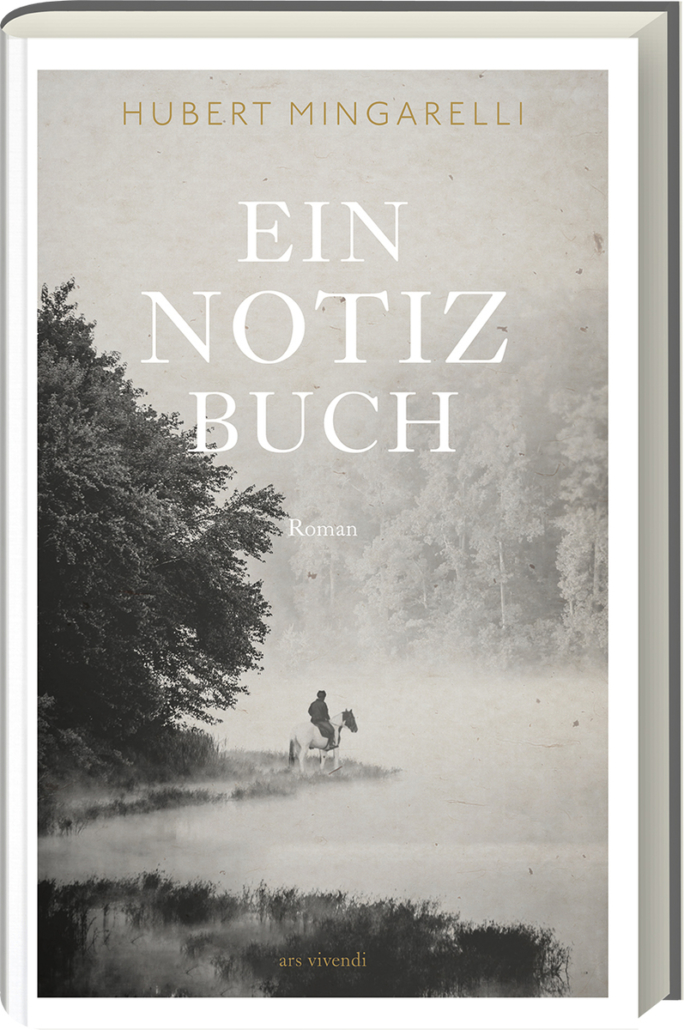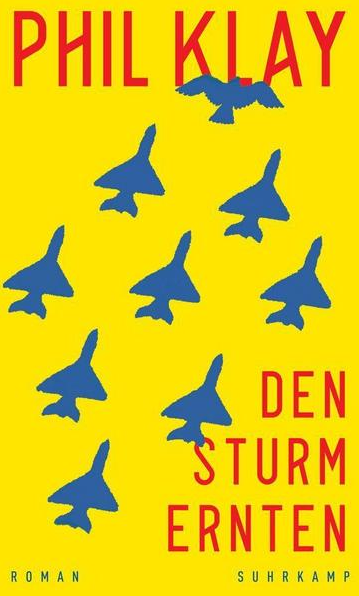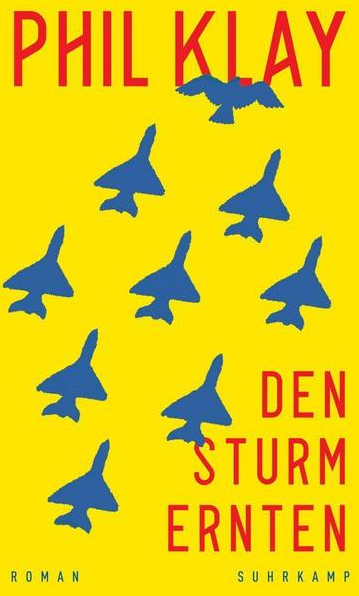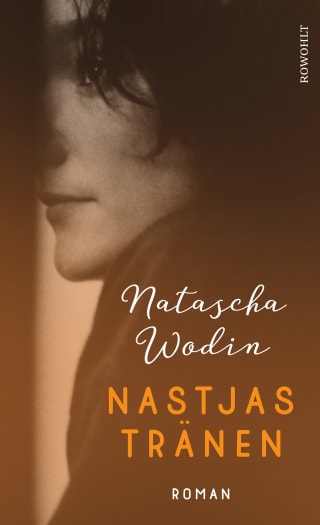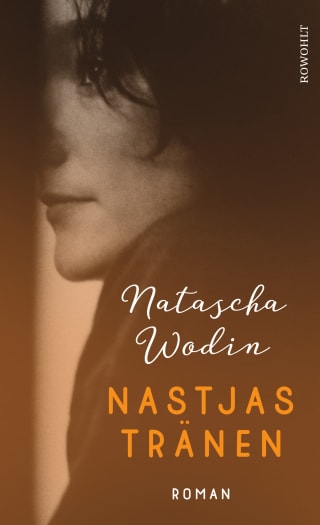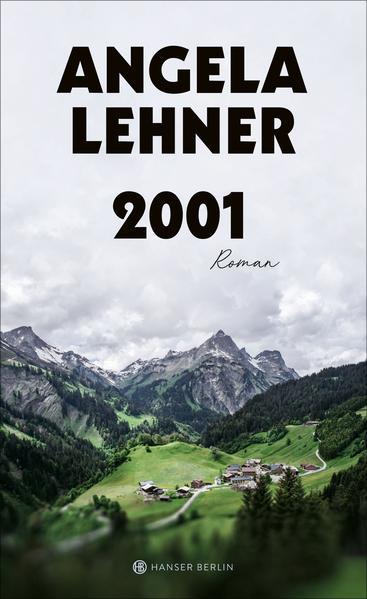Meine Stadt. Mein Buch. 2021

Die feuerrote Friederike bei „Meine Stadt. Mein Buch“
Im Rahmen der Leseförderaktion „Meine STADT. Mein BUCH.“ werden allen Kindern in Wien, die im Schuljahr 2021/2022 die 3. Klasse Volksschule besuchen, seit November ein Exemplar des Buches „Die feuerrote Friederike“ von Christine Nöstlinger geschenkt. Die Leseförderaktion wird von der Stadt Wien und der Wiener Städtischen Versicherung unterstützt. Die ersten 10.000 Exemplare sind bereits verteilt – die nächste Tranche wird aller Voraussicht nach im Jänner bzw. im Februar verteilt.
Fotos: Arman Rastegar

Auch dieses Jahr konnte im Rahmen dieser gelungenen Partnerschaft eine Lizenz für 20.000 Bücher ausverhandelt werden. Damit haben auch heuer die Schüler*innen dieser Altersklasse die Möglichkeit, ein Weihnachtsgeschenk von uns allen zu erhalten.
Das Buch
Mit Illustrationen aus der ersten Auflage von 1970 wird den Kindern (Zielgruppe: 3. Klasse Volksschule) erzählt, was einem alles passieren kann, wenn man anders ist.
Friederike hat feuerrote Haare. Aber das ist nicht das einzig Ungewöhnliche … Friederike kommt der Annatante und der Katze Kater wie ein ganz normales Mädchen vor. Aber alle anderen Leute lachen, wenn sie Friederike sehen. Besonders die Kinder! Die rufen: »Da kommt die feuerrote Friederike! Feuer! Feuer! Auf der ihrem Kopf brennt’s! Achtung, die Rote kommt!«
So ergeht es der armen Friederike, nur weil sie rote Haare hat. Aber da es keine gewöhnlichen roten Haare sind, die sie von ihrem Vater geerbt hat, geschehen ein paar ganz ungewöhnliche Dinge…
Die Wiener Städtische Versicherung war schon 2020 bei „Meine STADT. Mein BUCH.“ (Thomas Brezina: „Dicke Freunde“) dabei und unterstütz das Projekt auch heuer: Mag. Sabine Toifl, Leitung Werbung & Sponsoring:
„Die Wiener Städtische setzt sich seit vielen Jahren für den Nachwuchs ein, die Leseförderung steht dabei im Mittelpunkt unseres Engagements. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu unterstützen und sie beim Erlernen und Festigen der deutschen Sprache zu fördern, liegt uns besonders am Herzen. Wer liest, wird schlau, verbessert Sprachgefühl, Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit. Wir freuens uns, ‚Meine STADT. Mein BUCH.‘ auch in diesem Jahr zu unterstützen und hoffen, vielen Kindern eine Freude mit ihrem neuen Buch bereiten zu können!“