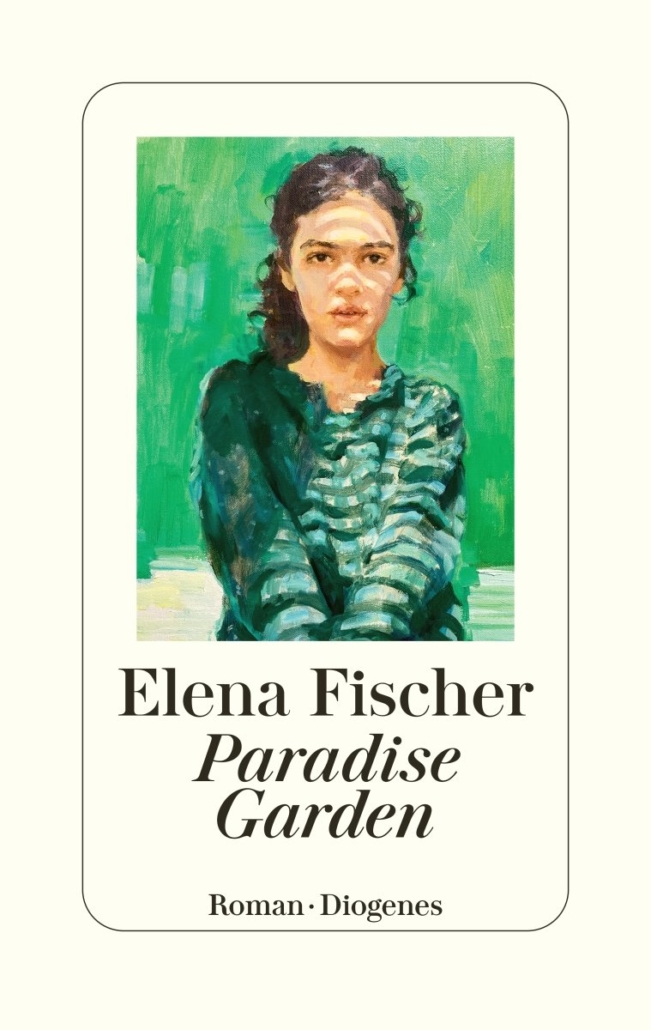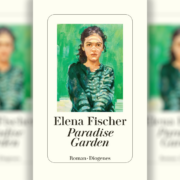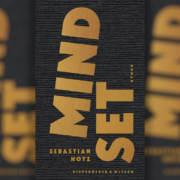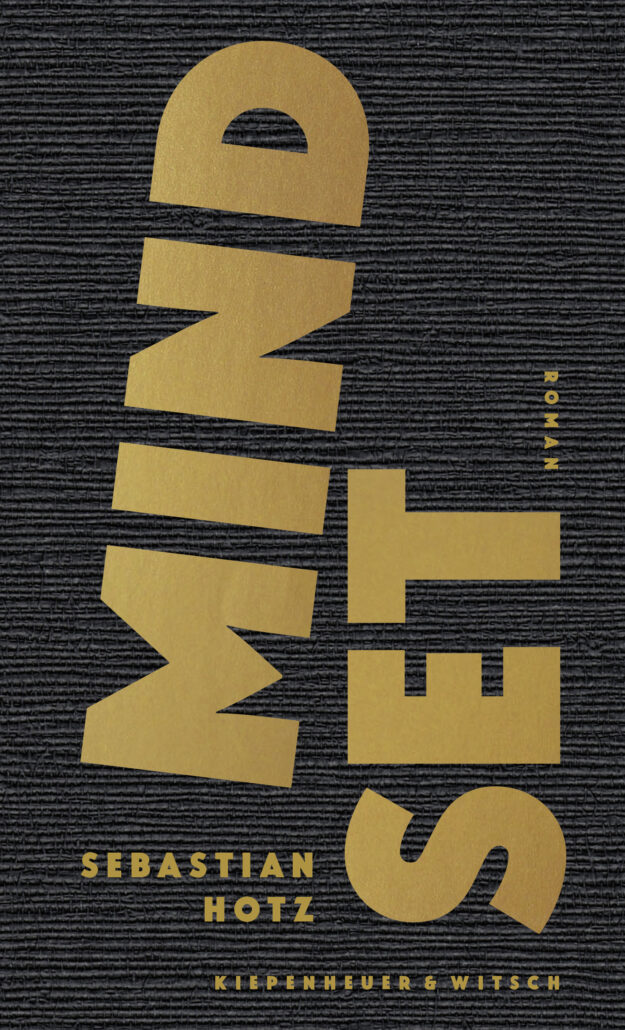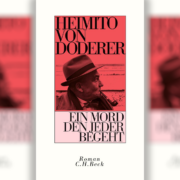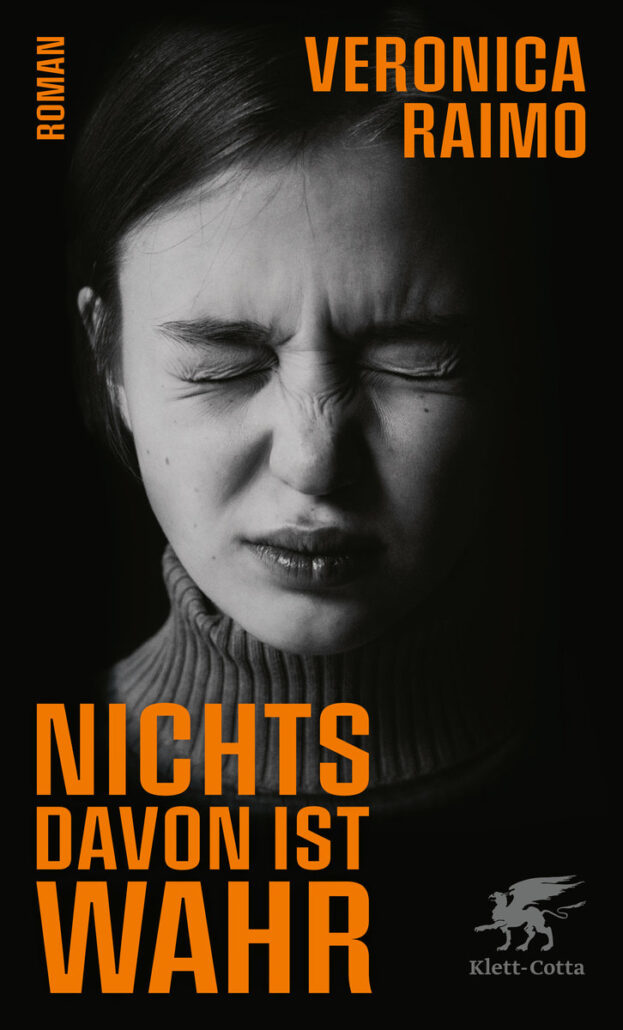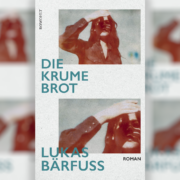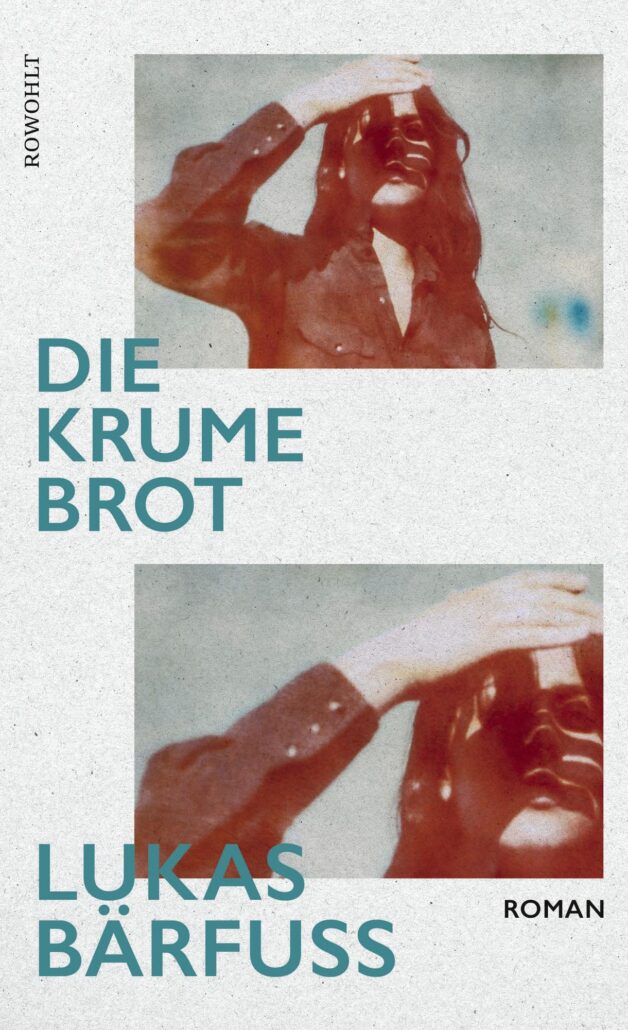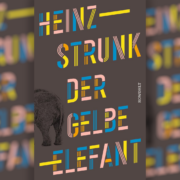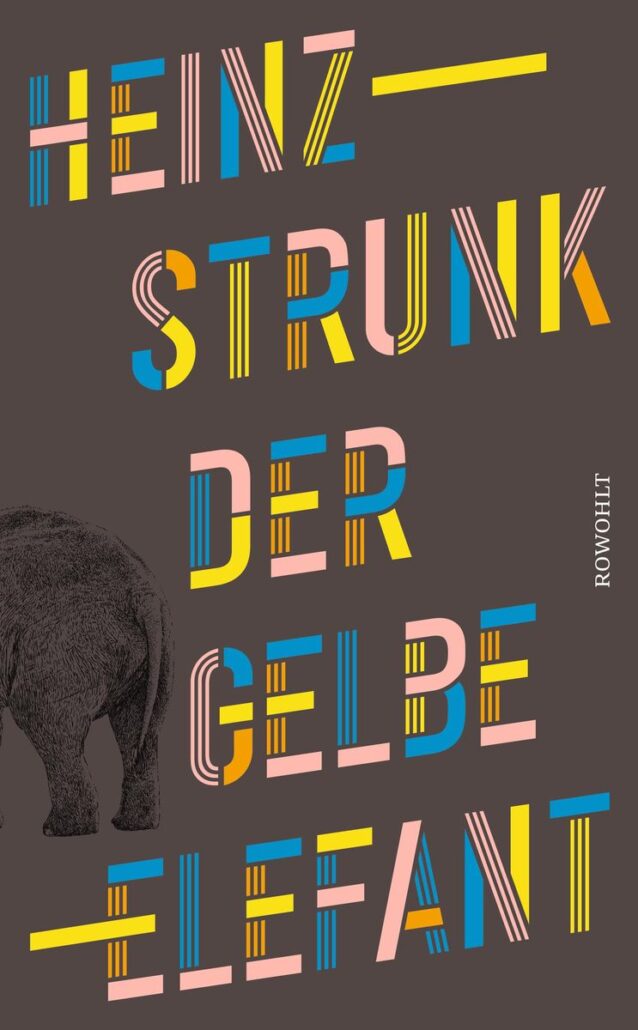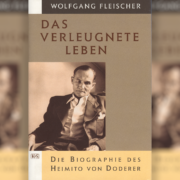Am 21. September feiern wir bereits den 3. D-Day für Doderer – Heuer im Justizpalast! Helmut Schneider spricht mit dem Historiker und früheren Leiter der Büchereien Wien Alfred Pfoser über den Justizpalastbrand in Doderers Roman „Die Dämonen“, Chris Pichler wird Stellen aus dem Roman vorlesen. Der Eintritt ist frei.
Heimito von Doderer (1896 – 1966) war zweifelsohne ein Monomane und sein Werk steht wie ein erratischer Block in der Landschaft der Literatur – sogar in der an Eigenwilligkeiten nicht mangelnden österreichischen. Trotzdem wollte der Autor der „Strudlhofstiege“ und der „Dämonen“ zeitlebens hinter seinem Werk als Person verschwinden, wollte ein „Autor ohne Biografie“ werden. Dass dergleichen zumal heutzutage nicht gelingen kann, ist offensichtlich. Aber bis 1996 nahm trotzdem niemand das Wagnis einer Doderer-Biografie auf. Da erschien bei Kremayr & Scheriau Wolfgang Fleischers fast 600seitiges Buch „Das verleugnete Leben – Die Biographie des Heimito von Doderer“. Fleischer war – als blutjunger Student – in den letzten 3 Lebensjahren des Autors so etwas wie sein Privatsekretär gewesen, Doderer hatte ihm Briefe diktiert und bald auch in seinem Namen schreiben lassen. Fleischers Doderer-Bio ist deswegen aber keineswegs unkritisch – im Gegenteil, er schont Doderer in keiner Phase seines Lebens, räumt mit Mythen auf und gibt ein faires Bild von dessen politischen Fehlern und Ahnungslosigkeiten. Sogar Doderers sehr spezielles Sexualleben wird – ohne sensations- oder sonstwie -lüstern zu werden – nüchtern aufgearbeitet. Leider ist dieses Schlüsselwerk zu Doderer nur noch als ebook lieferbar.
Lebensweg
Heimito von Doderer hatte alles andere als ein typisches Schriftstellerleben. Weder zeigte sich seine Begeisterung für Sprache früh – er war ein miserabler Schüler – noch wurde ihm sein Schriftstellerleben bis zum Erfolg der „Strudlhofstiege“ – da war er schon 55! – leicht gemacht. Die meiste Zeit war er von Zuwendungen – vor allem von seiner Mutter – abhängig und ganze 11 Jahre war er beim Militär, die Zeiten der Gefangenschaft mit eingerechnet. Ausgerechnet im russischen Gefangenenlager – Doderer geriet 1916 in Gefangenschaft – in Sibirien an der Grenze zu China entdeckte er die Dichtkunst und beschloss, Schriftsteller zu werden. Nun behandelten die Russen auch noch in den Zeiten des Bürgerkriegs nach der Revolution, Offiziere viel besser als normale Soldaten. Die Häftlinge konnten in den Lagern eine Art Schulprogramm aufbauen und die Kameraden konnten sich gegenseitig weiterbilden. Die vier Jahre in Krasnojarsk waren aber sicher nicht nur angenehm, viele starben an Seuchen. Und im Chaos des russischen Bürgerkrieges war auch die Rückkehr nach Österreich durch ganz Sibirien über Sankt Petersburg nicht ungefährlich.
In Wien studierte Doderer schließlich Geschichte und schaffte auch einen Abschluss, bemühte sich aber auch Erzählungen und journalistische Arbeiten bei Verlagen unterzubringen – mit mäßigem Erfolg.
Zu dieser Zeit hatte er auch eine erste Freundin. Mit der aus einer jüdischen Arztfamilie stammenden Gusti Hasterlik, katholisch getauften jungen Dame, die ihm bildungsmäßig stark überlegen war, ging er eine mehr als ein Jahrzehnt dauernde wechselvolle Beziehung ein, die in einer Ehe mündete – ausgerechnet als ihr Verhältnis längst getrübt war. Denn Doderer war nicht nur bisexuell – sein erster Geliebter als Schüler war sein Hauslehrer Albrecht Reif gewesen, der später auch mit ihm in Sibirien das Gefangenenlager teilte –, sondern hatte sehr spezielle Vorlieben. Besonders dicke Frauen erregten ihn und am meisten genoss er Folterspiele, wobei der die Auserwählten nicht wirklich verletzte, da er sich mit einer Samtpeitsche begnügte. Um das zu erklären würde es wohl einer psychoanalytischen Analyse bedürfen, klar ist aber, dass Doderer sich in seiner Familie immer unterdrückt fühlte. Sein Vater war einer der erfolgreichsten Bauunternehmer, der maßgeblich an vielen Eisenbahnprojekten und an der Regulierung des Wienfluss beteiligt gewesen war.
Krisenjahre
Doderer war zeitlebens politisch nicht interessiert, er sehnte sich nach einer Art idealen Vielvölkerstaat, doch diverse Krisen ließen ihn – der als Adeliger die Massen verachtete und nicht einmal ein Radio in seiner Wohnung duldete – gemeinsam mit seinem Freund, den Maler und Schriftsteller Albrecht Paris Gütersloh, 1933 in die NSDAP beitreten. Just als sich in Österreich gerade der Austrofaschismus etablierte und die Nazis verboten wurden. Doderer erhoffte sich bessere Möglichkeiten bei deutschen Verlagen und er schaffte es dann auch tatsächlich, Autor von C. H. Beck in München zu werden. Natürlich musste er dafür auch in die Reichsschrifttumskammer aufgenommen werden. Noch vor dem Krieg wurde freilich eine andere Bewegung für ihn viel wichtiger, zumal ihn die Nazis in ihrer tatsächlichen Herrschaft zunehmend widerlich wurden. Er trat als evangelischer Christ zum Katholizismus über und las mit Begeisterung die Schriften des mittelalterlichen Dogmatikers Thomas von Aquin. Ausgerechnet, denn Aquin schuf auch die Grundlagen für den so fatalen Hexenglauben – ein Hexenprozess kommt später auch in Doderers „Dämonen“ vor. Aber bald folgte sowieso seine Einberufung in die Wehrmacht. Doderer musste an viele Kriegsschauplätze, wenn auch nicht in vorderster Front – als Offizier soll er seine Mannschaft immer geschont haben. Bei Kriegsende wurde er in Norwegen gefangen genommen.
Sein NSDAP-Zwischenspiel wirkte sich nach dem Krieg dann äußerst ungünstig auf den noch immer um Anerkennung Ringenden aus. Es kostete ihm viel Zeit und Geld als unbelastet eingestuft zu werden. Der österreichische PEN, der ihn später für den Nobelpreis vorschlug, lehnte zweimal seine Mitgliedschaft ab. Doderer hatte zeitlebens viele jüdische Freunde und sogar Förderer. Nach dem Krieg verkehrte er etwa mit Hans Weigel und Hilde Spiel und selbst der in Sachen verdrängter Geschichte des Nazitums sehr sensible Helmut Qualtinger wurde zu einem Saufkumpan.
Erfolg
Das Erscheinen der „Strudlhofstiege“ 1951 änderte schließlich alles für ihn. Er wurde mit Ehren überschüttet und überall eingeladen, sein Underdog-Schicksal war Geschichte. Als 1956 „Die Dämonen“ herauskamen, war der Nobelpreis für ihn in Griffweite, denn erstaunlicherweise wurde das fast 1400-Seiten-Werk auch in andere Sprachen übersetzt – dabei ist ein sehr langes Kapitel in Mittelhochdeutsch geschrieben. Doch ein – natürlich anonymer – Brief im Umkreis des österreichischen PEN machte das Nobelpreiskomitee dezidiert auf Doderers NSDAP-Mitgliedschaft aufmerksam.
In den letzten Jahren seines Lebens schrieb Doderer an seinem Roman No7 – in Anlehnung an Beethovens 7. Symphonie, seinem Lieblingsstück, sollte dieses Werk vier Bände (Sätze) haben. Nur der erste – „Die Wasserfälle von Slunj“ – konnte vollendet werden und erschien 1963 als eigener Roman. Zwischendurch verfasste Doderer auch das „Schelmenstück“, seinen Roman „Die Merowinger oder Die totale Familie“. 1966 starb er – kurz nach seinem 70. Geburtstag – an einem zu spät erkannten Darmkrebs. Seine behandelnde Ärztin, die sich um das Begräbnis kümmerte, verhinderte das Abspielen des 2. Satzes der A-Dur Symphonie – der letzte Wunsch des Autors – weil sie das Werk als zu weltlich empfand.
Sein Biograf Wolfgang Fleischer – er starb 2014 – hatte sich später zu einem anerkannten Experten für Feuchtbiotope entwickelte und Seerosen gezüchtet.
INFO
Facebook.com/D-Day für Doderer