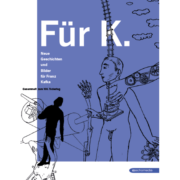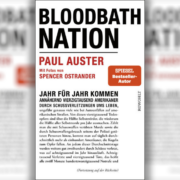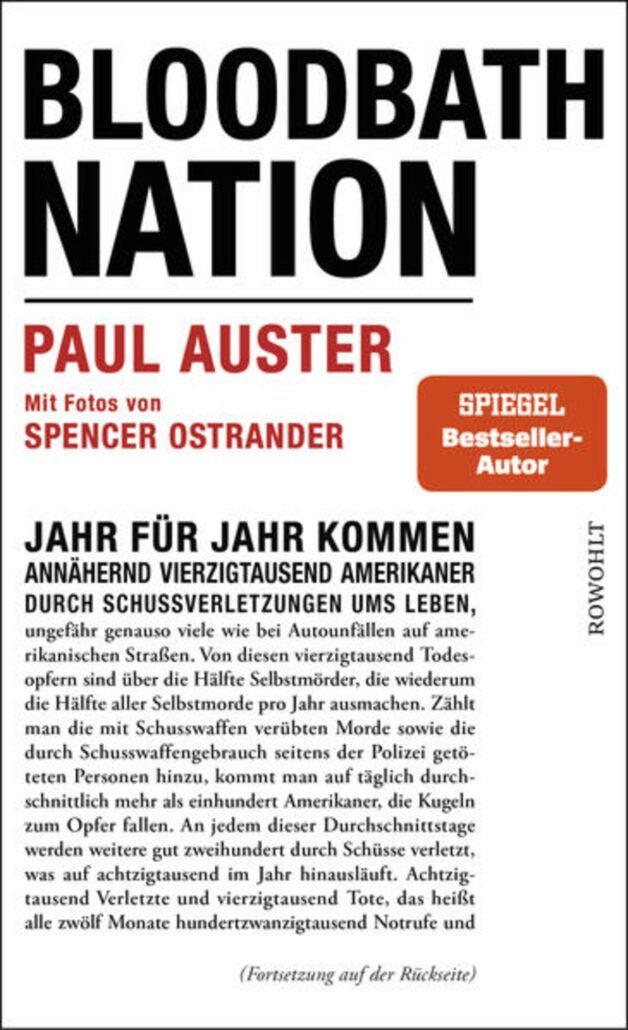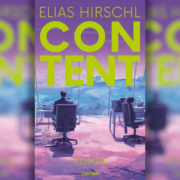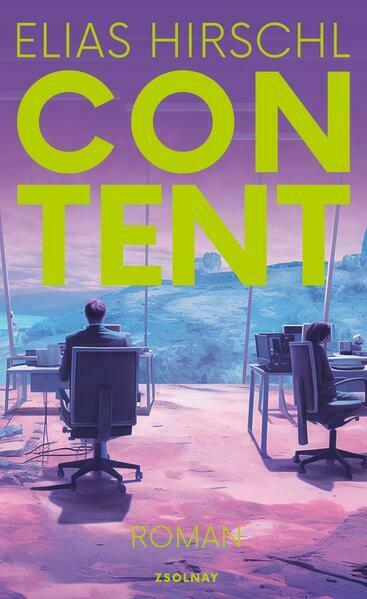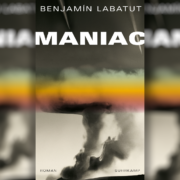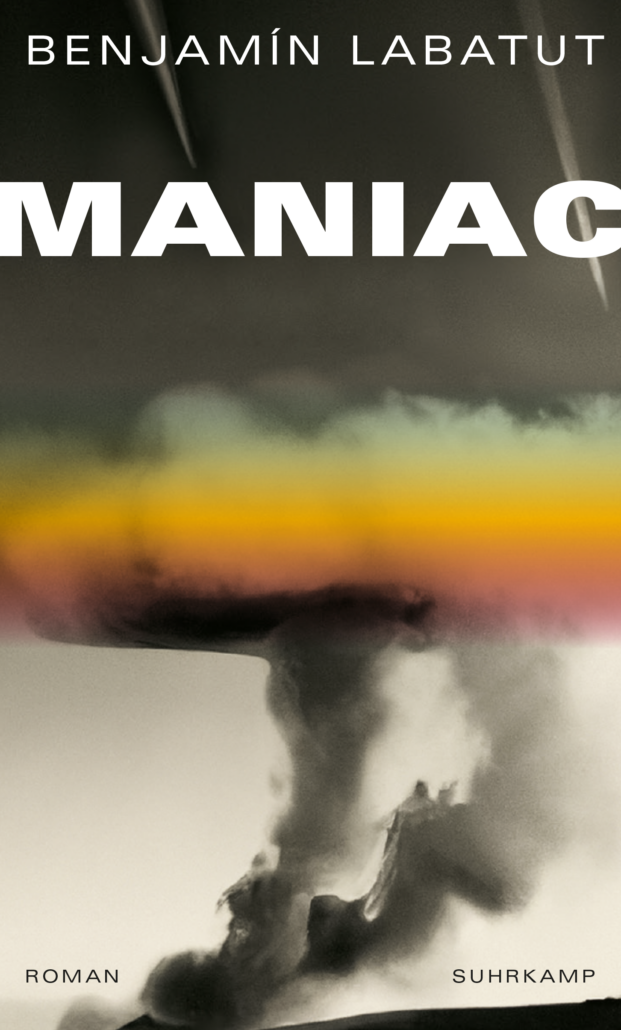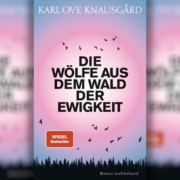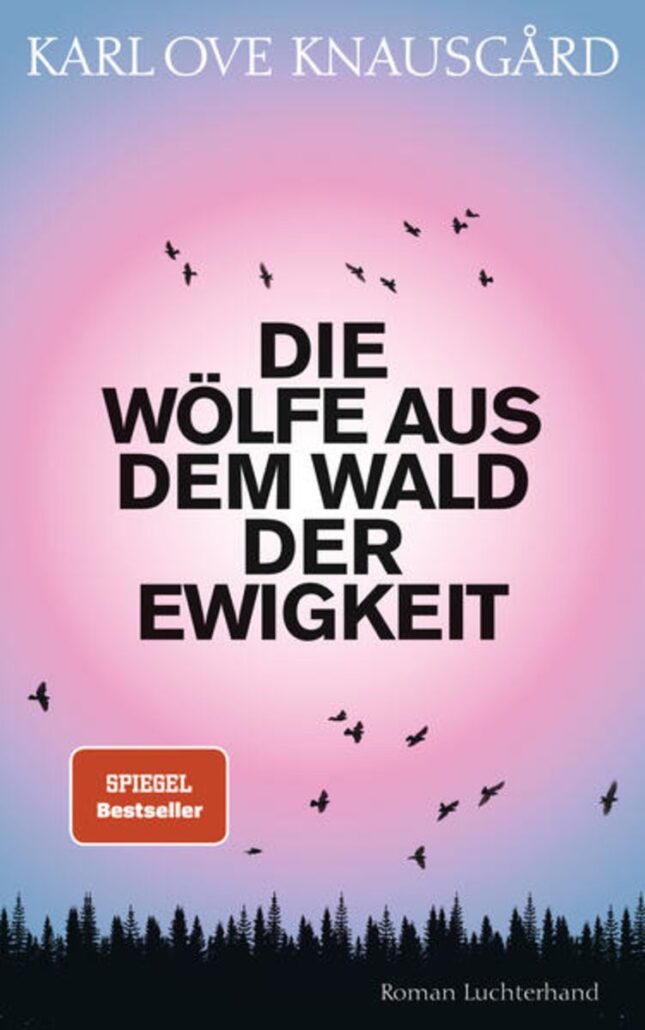Zunächst einmal: Das waren die kürzesten und angenehmsten 1000 Seiten (genau 1050) der letzten Jahre. Karl Ove Knausgård, der mit extremer und auch extrem ausufernder Autofiktion bekannt wurde, kann zweifelsohne interessant erzählen. Wenn er etwas spezieller schildert, dann hat das bei ihm einen Grund. Denn im zweiten Band seiner Morgenstern-Trilogie (der Abschlussband soll noch heuer erscheinen und liegt im Original bereits vor) befinden wir uns – bis auf einigen Einsprengseln – im Kopf zweier Geschwister.
Etwa 500 Seiten erzählt Syvert, der 1986 nach seinem Militärdienst in das Haus seiner Familie in Südnorwegen bei Bergen zurückkehrt, wo nur noch seine Mutter und sein kleiner Bruder Joar leben, denn der Vater ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Syvert weiß nicht so recht, was er mit seinem Leben anfangen soll – für die Uni bräuchte er noch ein paar Kurse und es ist sowieso Sommer. Mutter arbeitet viel und sein Bruder ist zwar unheimlich schlau, aber sozial etwas eigen. Er hört Heavy Metal, trifft frühere Freunde und verliebt sich schließlich in ein etwas kompliziertes Mädchen. Weil die Familie Geld braucht, tritt er einen Aushilfsjob bei einem Bestatter an.
Aber da ist das Thema des Romans sowieso bereits eingeleitet. Denn den Tod seines Vaters kann Syvert einfach nicht verstehen. Und dann findet er noch Briefe an den Vater in Russisch. Er hatte gar nicht gewusst, dass sein Vater diese Sprache beherrschte. Er lässt sie von einem schrulligen Privatgelehrten übersetzen und erfährt, dass sein Vater eine Geliebte in der Sowjetunion hatte. Ja mehr noch – vor seinem Tod, gesteht ihm die Mutter, wollte sein Vater die Familie verlassen. Reichlich Stoff zum Nachdenken für einen noch nicht 20jährigen, auch wenn Syvert nicht gerade als Intellektueller beschrieben wird. Zumal Vaters Geliebte im letzten Brief andeutet, schwanger zu sein. 1986 ist auch das Jahr, in dem Tschernobyl explodiert – die Nachrichten werden immer beunruhigender. Doch Knausgård schlachtet das überraschend wenig aus. Viel interessanter scheinen ihm die Ideen der Evolution oder was lebendige und unbelebte Materie voneinander unterscheidet. Bekanntlich ist ja alles, was jemals existierte und jemals existieren wird, bereits mit dem Urknall da und geht nicht verloren.
Im zweiten Part des Buches ist dann Alevtina die Hauptperson – wir sind etwa 40 Jahre später in der Jetztzeit, denn Alvetina ist das Kind der Briefschreiberin und somit Syverts Halbschwester in Russland. Sie ist ausgebildete Biologin, hat aber in den letzten Jahren ihren Job gewechselt und arbeitet nun als Ärztin. Erst als ihr Vater stirbt, hat sie den Mut, einen vor Jahren geschriebenen Brief Syverts zu beantworten und ein Treffen in Moskau vorzuschlagen. Dieses Zusammentreffen, das zunächst völlig schief zu gehen scheint, ist sozusagen der Abschlusshöhepunkt des Romans. Alvetina hat natürlich ihren leiblichen Vater niemals kennengelernt. Als junge Biologin wollte sie beweisen, dass die Bäume gemeinsam mit den mit ihnen in Symbiose lebenden Pilzen eine Art Bewusstsein haben. Eine Dichterfreundin interessiert sich währenddessen für einen russischen Utopisten, der nichts Geringeres als die Wiedererweckung all jener Toten in Angriff nehmen wollte, die jemals auf der Erde gelebt haben. Im Zuge ihrer Recherchen lässt sie sich Tanks zeigen, in denen heute schon Menschen für die Ewigkeit eingefroren werden. Die Transhumanisten im Silicon Valley sind da sicher schon weiter…
Alle Nebenstränge auch nur anzudeuten, ist kaum möglich. Wir erleben Schlägereien, Gewaltausbrüche, Überfälle und diverse Alkohol- und Drogenräusche. Am Ende erscheint auch wieder der helle Stern aus dem ersten Band auf dem Horizont und plötzlich sterben mehrere Tage lang keine Menschen.
Knausgårds „Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit“ ist ein faszinierender Roman über den Tod und die Versuche ihn zu überwinden, dargebracht in einer Familiengeschichte – bekanntlich das langlebigste und erfolgreichste Genre überhaupt.